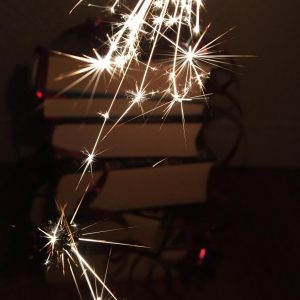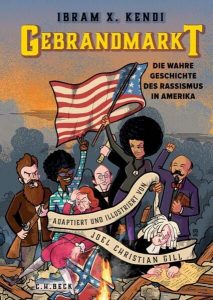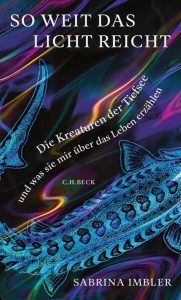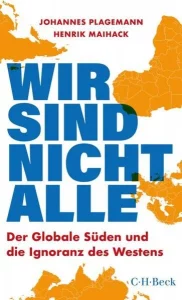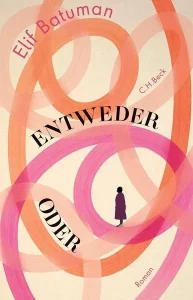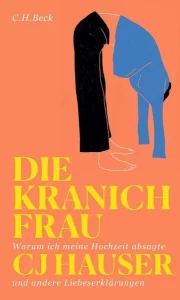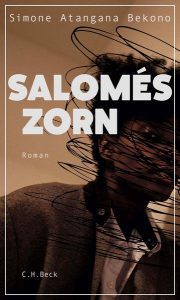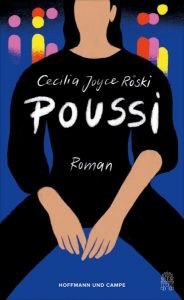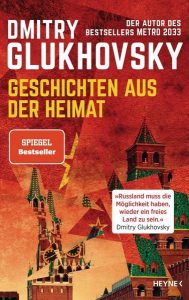Eine Frau sitzt hinter Gittern. So schreibt sich der Text dieses außergewöhnlichen Romans von Alia Trabucco Zerán, übersetzt aus dem Spanischen von Benjamin Loy. Eine Frau hinter Gittern, die einen 240 Seiten langen Monolog über ihr Dasein als Haushälterin bei einer wohlhabenden Familie hält. Eine Frau hinter Gittern, die ihre Unschuld beteuert und vermeintliche Fäden zieht, um zu erklären, wie es zu jenem schrecklichen Vorfall eines Morgens kam, als die kleine Tochter der Familie plötzlich und leise verstarb. Eine Frau hinter Gittern, die Estela heißt.
Estela beschreibt ihr Ankommen in der Familie, die Señora hochschwanger und kalt, der Señor erfolgreicher Arzt und beide stets adrett und wohlerzogen. Nie sind sie unhöflich zu Estela, nie versäumen sie es, ihr Gehalt zu überweisen, nie wird sie belästigt, und trotzdem erscheint sie in all den Jahren, die sie das Wachsen der Familie begleitet, wie ein Geist. Das Gefängnis, das das vornehme Haus für sie stets darstellt, wechselt sich mit jenem Gefängnis ab, in dem sie sich befindet, während sie erzählt. Ein Gefängnis, das aus verdunkelten Scheiben zu bestehen scheint, hinter denen sie Menschen wähnt, die ihr zuhören, die herausfinden wollen, wie das Mädchen starb und ob sie, die Haushälterin, die triefnass in das Elternschlafzimmer stürmte und zu Señor und Señora sagte „Das Mädchen ist tot“, die Schuldige an diesem Tod ist.
Weiterlesen