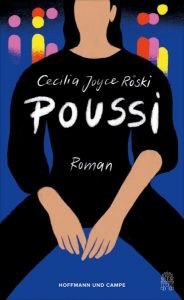Der Roman „Poussi“ von Cecilia Joyce Röski ist schon der zweite von mir rezensierte Roman, der ein Leben im Rotlichtviertel beleuchtet. Doch auch wenn das Thema dasselbe ist wie in „La Maison“von Emma Becker, erzählt Röski doch eine völlig andere Geschichte. Aus wie vielen Perspektiven lässt sich ein Leben betrachten? Von außen, von innen, in Wahrheit, in Selbstbetrug? Letzteres scheint in „Poussi“ der Fall zu sein.
Die Anfang 20-jährige Ibli lebt und arbeitet im „Palast“, einem Bordell, das ihr Vater, von allen nur Lackschuh genannt, gegründet hat und in dem schon ihre Mutter sich prostituierte. Ibli ist in dem Etablissement aufgewachsen und hat die Welt draußen schon lange nicht mehr betreten. Ihr ganzes Universum besteht aus ihrem kleinen Zimmer, in dem sie die „Poi‘s“ und „Adoinis‘se“ empfängt, schläft, isst, ihren Staubsaugroboter umsorgt und sich an ihre beste Freundin Zola kuschelt.
Welt wie in Watte
Es ist eine Welt wie in Watte gepackt, in der die Bodis und Zipfel (Penisse) der wechselnden Bois nur eine Nebenrolle spielen, die Freundschaft zu Zolinchen und den anderen Mädchen sowie das Zimmer ohne Fenster als Konstanten dafür aber umso wichtiger sind. Mangelnd anderer Lebewesen als Männern und Mädchen vermenschlicht Ibli die Gegenstände in ihrem Zimmer, der Staubsauger saugt und saugt, „ohne daran zu denken, ob das jetzt sinnvoll ist. Ich möchte dich streicheln wie einen Hund, dabei weiß ich doch, dass du kein Hund bist. […] Sein Blinken ist für mich wie ein Giggeln. Seine Oberfläche ist von einer leichten Staubschicht bedeckt, die er natürlich nicht wegsaugen kann, und darüber muss ich irgendwie lachen. Was freue ich mich so sehr über dich?“
Hineingeworfen in die seltsame Sprache der Protagonistin fragte ich mich über die Hälfte des Romans hinweg, ob die Geschichte überhaupt in der weltlichen Realität spielt, wie wir sie kennen. Doch, ja, nichts spricht dagegen. Was allerdings spricht, und zwar laut, ist die sprachliche Verniedlichung der Tatsache, dass Ibli seit ihrer Jugend als Prostituierte arbeitet, eine lieblose Kindheit lebte und den Kontakt zu ihren Eltern verloren hat, dass sie nichts kann und nichts weiß, was das Leben außerhalb des Palasts betrifft. Dies wird vor allem gegen Ende der Geschichte deutlich, als sowohl Ibli als auch Zola den Palast verlassen haben, sich der Realität stellen – und versagen. Und dass es alles andere als ein Selbstbetrug ist, den die Protagonistin die ganze Geschichte über vornimmt: Die eigene Wahrheit kann schließlich keine Lüge sein. (Oder?)
Naive Persönlichkeit
Doch wo kommt das her, ihre allzu naive Persönlichkeit, der immense Mangel an Reflektion? Im Gegensatz zu vielen anderen Fragen wird diese uns beantwortet. Denn Iblis Geschichte begleitend erleben wir zeitversetzt die Anstrengungen, die es ihren Vater Lackschuh kostete, sein Leben zu führen. Nach Verlust seines Bordells verliert er sich in Automaten-Glücksspielen, in deren fantastischer Unterwasserwelt, in der er Delfine bezahlt, um Geborgenheit von ihnen zu erhalten, in der er sich vorgaukeln kann, alles sei gut. Letztendlich verspielt er sein Hab und Gut, verliert den Kontakt zu seiner Tochter, kann weder deren Mutter noch seine Ehefrau jemals glücklich machen und findet auch selbst keinen Anschluss mehr in seiner begrenzten Welt. Alles Vermögen ist dahin, das Haus verschimmelt und jeglicher Hauch von Eleganz hat den alternden Mann verlassen. Er hat sein Leben verspielt – im wahrsten Sinne des Wortes, doch gewonnen hat dabei niemand.
Am Ende stehen uns zwei Charaktere gegenüber, beide auf ihre eigene Art und Weise am Rande der Realität und Gesellschaft wandelnd und tief in ihren Traumpalästen lebend. Sie existieren in Traumgebilden und vermögen es nicht, diese zu verlassen, selbst wenn man sie schon längst auf die Straße gesetzt hat.
Rosarote Brutalität
Cecilia Joyce Röski erschafft eine Welt, die aus rosaroter Brutalität besteht und hinter ihrer Weichzeichnung hart ist wie Zuckerwatte, die man in der Hand zerdrückt. Am Ende ist da nur noch ein klebriger Klumpen Zucker, den runterzuschlucken alles andere als ein Genuss ist. „Poussi“ ist ein Werk, das in seiner Andersheit besticht, auf das sich einzulassen, ein, zwei, drei Momente dauert, und das einen mit einer übersättigten Leere zurücklässt.
Es ist das Meisterwerk eines Debütromans und ich erwarte noch viel von der jungen Autorin. Denn es gibt unendlich viele Perspektiven, diese Welt zu betrachten und Wahrheiten zu erschaffen, die dem Mainstream widersprechen. Und so auch das Thema des Romans düster ist, die beiden Geschichten verzweifelt, fühlte ich mich die meiste Zeit wie in einer Playmobilwelt – eine Kunst, die ich nicht vielen Schreibenden zutraue und von der ich mehr sehen möchte. Diese Geschichte ist etwas für alle euch, die ihr euch einlassen wollt auf eine etwas andere Perspektive und auf eine Sprachkunst, die es vermag, Playmobilfassaden vor die Realität zu setzen.
Cecilia Joyce Röski: Poussi.
Hoffmann & Campe, Februar 2023.
264 Seiten, gebundene Ausgabe, 24,00 Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von Jana Luisa Aufderheide.