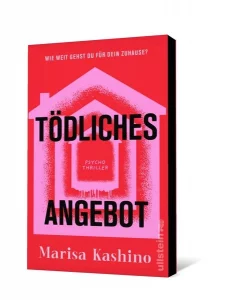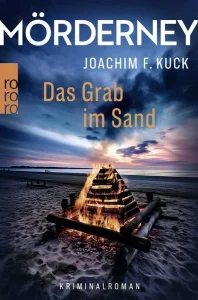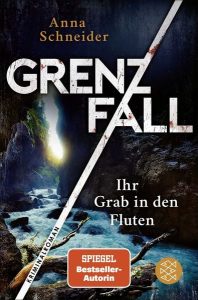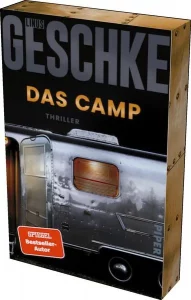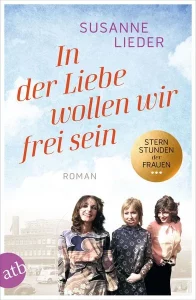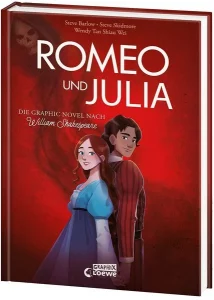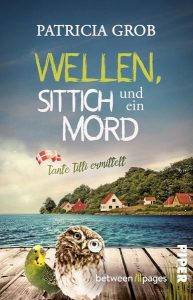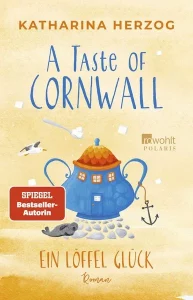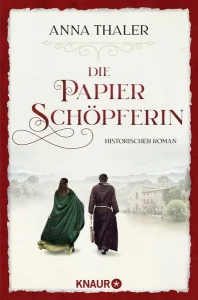Der Wunsch nach einem eigenen Haus, in dem das so sehr ersehnte, noch nicht geborene Kind aufwachsen soll, wird für Margo übermächtig. Während Jan, ihr Mann, alles deutlich entspannter sieht, entwickelt sich Margos Sehnsucht nach dem Traumhaus zur Obsession. Ihre biologische Uhr tickt, und bislang sind alle Versuche, schwanger zu werden, gescheitert. Ihre Gynäkologin meint, sie setze sich zu sehr unter Druck. Margo denkt darüber nach, Eizellen einfrieren zu lassen – für alle Fälle. Gleichzeitig ist sie fast sicher, dass es mit dem Schwangerwerden klappen wird, sobald sie ihr neues Heim gefunden haben und aus der beengten Wohnung ausziehen können.
Die Erfüllung dieses Wunsches scheint greifbar nah, als Ginny, ihre Maklerin, anruft und von einem Haus in bester Wohnlage erzählt. Es wird noch nicht offiziell angeboten, doch Ginny weiß sicher, dass es verkauft werden soll, weil die Besitzer Washington aus beruflichen Gründen verlassen und nach London ziehen wollen. Das habe ihre Schwägerin berichtet, die mit einem der beiden Eigentümer im selben Fitnessstudio trainiert. Dieser Anruf verändert für Margo alles. Diesmal muss es gelingen.
Weiterlesen