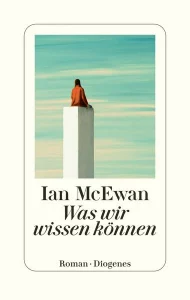Der Brite Ian McEwan (Jahrgang 1948) ist ein brillanter Schriftsteller. Viele seiner Romane wurden ausgezeichnet und verfilmt. Auf dieser Homegage haben wir zuletzt „Lektionen“ aus dem Jahr 2022 besprochen.
Am 24. September 2025 veröffentlichte der Diogenes Verlag sein neuestes Werk mit dem Titel „Was wir wissen können“. Bernhard Robben hat es aus dem Englischen übersetzt.
„Was wir wissen können“ von Ian McEwan ist eine Dystopie oder nicht?
Im ersten Teil des Romans spielt „Was wir wissen können“ im Jahr 2119. Die Welt wurde überschwemmt, England und Europa sind nunmehr in Inseln zerstückelt. Die Weltbevölkerung ist um die Hälfte auf vier Milliarden geschrumpft. Demokratie, Wirtschaft und Freiheit sind Katastrophen, Kriegen und Atomschlägen zum Opfer gefallen. Der englische Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe beschäftigt sich mit der Literatur von 1990 bis 2030.
Er ist besonders fasziniert von einem Gedicht, das nur ein einziges Mal vorgetragen wurde und seit dem als verschollen gilt. Der berühmte (fiktive) Dichter Francis Blundy hat es 2014 für seine Frau Vivien geschrieben. Das Gedicht mit dem Titel „Ein Sonettenkranz für Vivien“ wurde im Oktober 2014 anlässlich Viviens 54. Geburtstag beim „Zweiten Unsterblichen Abendessen“ von Blundy vor einem kleinen Kreis von Gästen vorgelesen. Danach überreicht er Vivien das einzige Exemplar des auf Pergament geschriebenen Gedichtes. Thomas Metcalfe ist besessen davon, das Gedicht wieder zu finden. Er studiert akribisch jede Information zu dem Ehepaar Blundy, die auffindbar ist. Seine Freundin und Kollegin Rose Church wirft ihm vor, in der Vergangenheit zu leben, sie zu romantisieren und in Vivien verliebt zu sein. Metcalfe rekonstruiert das Leben der Blundys, recherchiert, verfolgt die kleinsten Spuren und kommt doch dem Fund des Gedichtes keinen Schritt näher. Bis ihm der Zufall hilft und ein kleines Mathegenie den entscheidenden Tipp gibt. Aber kann er tatsächlich den verschwundenen Gedicht-Schatz heben?
Dann beginnt Teil Zwei des Romans von Ian McEwan. Nun finden sich die Lesenden im Jahre 2014 wieder. Vivien Blundy wird zur Ich-Erzählerin, die ihr Leben aus ihrer Perspektive beschreibt: ihre erste Ehe mit dem Geigenbauer Percy Greene, ihre Affäre, die Alzheimer-Erkrankung ihres Ehemanns, Francis Blundy, Percys Unfalltod, ihre Ehe mit dem berühmten Dichter, das „Zweite Unsterbliche Abendessen“. So wie es wirklich gewesen ist oder „was wir wissen können“.
Was ist die Wahrheit oder Wirklichkeit und wie sollen wir das wissen?
Die Idee von Ian McEwan ist genial: in einer dystopischen Zukunft sucht ein Literaturprofessor in England nach einem verschwundenen Gedicht aus der Vergangenheit, die unsere Gegenwart ist. Dabei spart McEwan nicht mit dem „was wir wissen können“ über den Zustand der Welt, der schließlich in die große Katastrophe, die Überflutung im Jahre 2042 mündet:
„Die Völkergemeinschaft steuere immer schneller in die falsche Richtung. Dann folgte die lähmende Aufzählung: Überflutungen, Dürren, Taifune und Wirbelstürme, Waldbrände – und dies in zunehmender Häufigkeit; Messungen in diversen wissenschaftlichen Disziplinen bestätigten die fortschreitende Übersäuerung der Meere, schmelzendes Polareis, Gletscherrückzug, Anstieg des Meeresspiegels, immer höhere Oberflächentemperaturen. Kolossale Migration, Pandemien, Ressourcenkriege und prognostiziertes Artensterben – und so weiter und so weiter.“ (S. 53/54)
Das macht den ersten Teil des Romans so spannend. Wir wissen das heute alles und machen trotzdem ignorant und unverbesserlich weiter wie bisher. Demgegenüber gerät Thomas Metcalfes angestrengte Suche nach jedem Detail aus dem Leben von Vivien und Francis Blundy, bis hin zu einer akribischen Nachstellungen des „Zweiten Unsterblichen Abendessen“ einschließlich der Dialoge zwischen den Gästen, für mich als Lesende etwas zu lang und ausführlich. Zumal dies auch zu Wiederholungen des schon Erzählten führt. Letztendlich bleibt Metcalfes Suche nach der einen Wahrheit oder der einen Wirklichkeit trotz der „drei Millionen Interneterwähnungen von Francis Blundy allein während seiner Lebenszeit…, seinen 219 000 SMS, an ihn oder von ihm, sowie den nahezu unzähligen, seither erfolgten Erwähnungen seines Namens“ (S. 185) erfolglos. Denn die Geschichte über das berühmte Gedicht, die Ian McEwan Vivien Blundy in der zweiten Hälfte des Romans erzählen lässt, ist eine andere.
Ian McEwan gaukelt seinen Lesenden meisterhaft vor, dass es sich um reale Recherchen des Literaturwissenschaftlers Metcalfe handelt bis hin zu seinem Vergleich mit dem angeblichen ersten unsterblichen Abendessen 1817 bei dem (realen) Maler Ben Haydon mit William Wordsworth, John Keats und Charles Lamb. Im Internet finden sich für all dies scheinbar Belege. Dieses Spiel mit dem „was wir wissen können“ und was wir glauben zu wissen, ist der Reiz, der mich verlockt, Seite um Seite mit Spannung und Energie zu lesen.
Und wie aktuell Ian McEwans Roman ist, zeigt uns heute der Einfluss von Sozialen Medien, Internet, KI, Chat GPT, Fake News, Bots, Trollen, InfluencerInnen und so weiter und so weiter auf unsere Wahrnehmung und die Schlüsse, die wir daraus ziehen oder vielleicht eher, die für uns daraus gezogen werden:
„Für das Abflauen der Klimabewegung im 21. Jahrhundert wurden viele Gründe genannt. Ich würde die Disruption selbst anführen. Die Lage auf dem Planeten mit seinen fast zweihundert rivalisierenden Nationen war bereits angespannt. Manche Historiker hielten 2022 und den russischen Einmarsch in die Ukraine für den Beginn des neuen dunklen Zeitalters.“ (S. 163/164)
„Was wir wissen können“ von Ian McEwan ist ein Roman, der erschreckt, aufrüttelt und sehr, sehr nachdenklich macht. Bitte unbedingt lesen!
Ian McEwan: Was wir wissen können.
Aus dem Englischen von Bernhard Robben.
Diogenes Verlag, 24. September 2025.
480 Seiten, Hardcover, 28,- Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von Sabine Sürder.