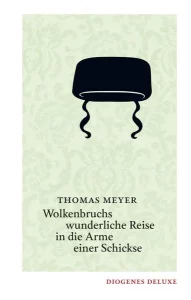Mordechai Wolkenbruch, genannt Motti, Sohn einer strenggläubigen und auf strikte Einhaltung aller Regeln bedachten Mutter, befindet sich auf der Suche. Zum einen nach der Liebe – mit 25 ist er immer noch Jungfrau – zum anderen nach der für ihn passenden »Art, jüdisch zu sein«.
Das Buch ist ein Entwicklungsroman im klassischen Sinne, aber von der ausschließlich leichtfüßigen Art, auch wenn Motti mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen hat wie der übergriffigen Mutter, die ihn unentwegt zu verkuppeln versucht (zu seinem Leidwesen ausschließlich mit Frauen, die ihr viel zu ähnlich sind), und der unerreichbar erscheinenden, angehimmelten Laura, einer Schickse, sprich, einer Nichtjüdischen Frau (was, wie wir erfahren, im Jiddischen neben dem reinen Fakt auch eine besonders erotische Ausstrahlung beinhalten kann).
Motti ist ein Mann auf der Suche nach dem Glück. Wobei nach dem Diktum seiner Mutter Glück »etwas für die Märchenbücher [ist]. Und zwar für gojische Märchenbücher.«
Doch Motti lässt sich nicht entmutigen. Im Gegenteil. Sein erster, nachgerade revolutionärer Schritt besteht darin, sich eine neue – moderne – Brille bei einem Goi, einem nicht-jüdischen Optiker zu kaufen. Des Weiteren ersteht er einen Rasierapparat, mit dem er sein »jiddisches Gestripp« in einen kurzen, »regelmäßigen tepech« verwandelt. Seine »mame«, dem Herzinfarkt nahe, schickt ihn zum Rabbi. Doch statt ihm die Leviten zu lesen, empfiehlt der ihm eine Reise nach Israel (die sich als vollständig kontraproduktiv erweist) und macht ihn mit Led Zeppelin bekannt.
Wie zu erwarten verschärfen sich die familiären und seelischen Konflikte, je näher er Laura kommt. Beständig schwankt Motte zwischen der Reue »über den Niedergang meiner familiären Verhältnisse und meiner jiddischkajt« und der Freude über die Folgen seiner allmählichen Abnabelung, »hinausrumpelnd in die gojische Wildnis, direkt vor di fis fun di nakete schikse.«
Mit großer Anteilnahme folgen wir Motti auf seiner in der Tat wunderlichen Reise und lernen nebenbei so einiges über Leben und Gebräuche einer jüdischen (in diesem Fall Züricher) Gemeinde, von den Verkuppelungsstrategien bis zum morgendlichen Ritual des Händewaschens und den Zwiegesprächen mit »G’t«; mit einem, in Mottis Fall, sehr verständnisvollen Gott, der ihm bestätigt, eine Mutter zu haben »mit einem leichten Hang ins Anstrengende […]; selbst für jüdische Verhältnisse«, und ihm anschließend »a gitn tog«wünscht.
Das Sahnehäubchen dieser Erzählung ist die Sprache, die sich auf ebenso »wunderliche« Weise perfekt in den Kontext einfügt.
Zum einen vermischt Meyer, wie an den Zitaten schon zu erkennen, Hochdeutsch und Jiddisch, was auf den ersten Seiten den Lesefluss ein wenig hemmen mag. Doch die Ähnlichkeit der eingeflochtenen Wörter und Wendungen mit dem Deutschen erleichtert das Verständnis. Das Verzeichnis der schwierigeren jiddischen Begriffe im Anhang benötigt man schon bald nur noch selten, sind dem Leser Wörter wie »schtups« und »tuches« doch schnell vertraut (finden Sie es selbst heraus!).
Zum anderen verfeinert Meyer seine Erzählung immer wieder mit überraschenden, ungewöhnlichen und heiteren Wendungen und Sprachbildern. Da wird eine Frau beim Betreten eines Lokals »mit Männerblicken besprenkelt«, »ein Windchen flinkte durch die Blätter des Baumes« und beim Nach-Hause-Weg mit der Angebeteten »glitzerten die Worte, es funkelten die Schritte und es gleißte das lebn.«
Wenn es um die Darstellung jüdischer Kultur geht, insbesondere in komödiantischer oder satirischer Form, sieht man sich schnell dem Vorwurf ausgesetzt, antisemitische Ressentiments zu bedienen und zu verstärken. Auch Meyer, selbst Jude, greift in seinem satirischen Roman auf gängige kulturelle und charakterliche Klischees und Stereotype zurück. Der Comedian Oliver Polak, der in seinem Programm regelmäßig Witze über Juden macht, sagt dazu: »Ich darf das, ich bin Jude.« Das reicht sicher nicht aus, um den Vorwurf des Antisemitismus vollständig zu entkräften. Klischees und Übertreibungen gehören allerdings zu den grundlegenden Stilmitteln der Satire, wie auch in »Wolkenbruchs wunderliche[r] Reise«, aber sie werden hier an keiner Stelle verachtend oder bösartig eingesetzt. Meyer beschreibt seine Figuren eher mit der kritischen und gleichzeitig augenzwinkernden Selbstironie, die man dem jüdischen Humor nachsagt (was natürlich selbst schon wieder ein Klischee ist).
So bleibt als persönliches Fazit: Thomas Meyers Buch ist ein absolutes Lesevergnügen. Auf Seite 267 werden Sie bedauern, dass es schon zu Ende ist.
Thomas Meyer: Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse.
Diogenes Verlag, Nov. 2025.
267 Seiten, Hardcover, Diogenes Deluxe Nov. 2025.
(Neuauflage des Taschenbuchs von 2014)
Diese Rezension wurde verfasst von Wolfgang Mebs.