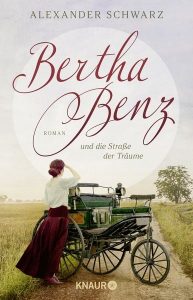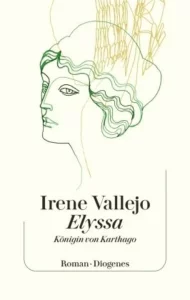Es ist ein bisschen, wie wenn man in einem Buch die letzte Seite zuerst liest.
Man kennt den Ausgang der Geschichte ja und weiß, es ist kein Happy End! Insofern ist dieser biografische Roman von Anfang an bedrückend. Das missglückte Attentat auf Hitler, am 20. Juli 1944, jährt sich zum 80. Mal, das Erscheinungsdatum des Buches ist also sicher nicht zufällig gewählt. Vielleicht sollte man im Geschichtsunterricht durchaus auch mal solche Bücher einsetzen, statt nur trockener Daten, Fakten und Namen, die sich die Wenigsten merken können oder wollen. Das ein oder andere „Geschichtsbuch“ dieser Art würde vielleicht einiges zum besseren Verständnis beitragen. Auch wenn die Autorin betont, dass die Handlungen ihres Romans fiktiv sind, dass der Roman vor allem eine Liebesgeschichte sei, orientiert sie sich doch eng an den historischen Personen und Ereignissen. Sie hatte nicht den Anspruch, eine Biographie zu schreiben, wohl aber den Wunsch, durch Erfundenes Wahres sichtbarer zu machen. Ich finde, dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Charlotte Roth erzählt uns eine wunderschöne und tieftraurige Liebesgeschichte. Die Geschichte von Nina, Tochter des fränkischen Generalkonsuls und einer baltischen Freifrau. Ihre Familie lebt in Bamberg.
Weiterlesen