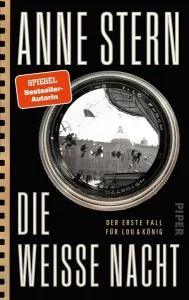Soviel vielleicht gleich vorweg: Dieser tiefgehende, oft beklemmende, ruhig erzählte Kriminalroman ist nichts für Leserinnen und Leser, die auf schnelle Wendungen, viel Action und möglichst kurze Kapitel stehen. Anne Stern versteht es wieder einmal, die Lesenden mitzunehmen in eine Atmosphäre, die eher düster ist und manchmal hoffnungslos scheint. Berlin im zweiten Hungerwinter, Dezember 1946. Die Stadt liegt in Trümmern, Ruinen bestimmen das Bild; daran ändert auch die dichte Schneedecke nichts, die das darunterliegende Elend zudeckt.
Die Menschen leiden Hunger und Not, haben oft noch immer kein Dach über dem Kopf, leben von dem, was sie auf dem Schwarzmarkt tauschen oder sonst wie ergattern können. Tote gehören noch immer zum Alltag, doch diese junge Frau, die die Fotografin Marielouise „Lou“ Faber im Schnee in den Ruinen entdeckt, als sie wieder einmal mit ihrer Kamera auf Streifzug ist, passt hier nicht ins Bild. Etwas an der Art, wie die Leiche der jungen Frau abgelegt worden ist, irritiert Lou. Noch kann sie nicht greifen, woran sie das erinnert, aber es lässt sie nicht los.
Später sagt sie das auch dem ermittelnden Kommissar Alfred König, der zugeben muss, auf die Fotos angewiesen zu sein, die Lou am Fundort der Leiche gemacht hat. So kommen sie ins Gespräch, und König erkennt, dass Lou ihn mit ihren eher intuitiven Denkansätzen – ihn, der sich gewohnheitsmäßig ausschließlich an Fakten orientiert – bei den Ermittlungen unterstützen kann. Gemeinsam verfolgen sie verschiedene Spuren, jeder für sich, tauschen sich aber immer mal wieder aus, nachdem sie so etwas wie Vertrauen zueinander gefasst haben. Schließlich ist es wirklich Lous Intuition zu verdanken, dass sie den richtigen Weg einschlagen und Verbrechen auf die Spur kommen, die in der NS-Zeit begangen wurden und jetzt offenbar gesühnt werden sollen.
Es geht nicht nur um die Frage „Wer war’s?“, es geht um das Gefühl einer ganzen Zeit: Verdrängen, Vergessen, Überleben. Man hat beim Lesen das Gefühl, mittendrin zu sein in diesem schrecklichen Winter, in diesen Ruinen, zu frieren wie die Menschen, die nicht genug Holz zum Heizen finden konnten, zu hungern, weil man keine Tauschware auf dem Schwarzmarkt anbieten konnte.
Gerade diese Schilderungen tragen dazu bei, diesen Roman authentisch wirken zu lassen. Ein Kommissar, der im Krieg ein Auge verloren hat, weil er einen Befehl verweigert hat und der deshalb längere Zeit inhaftiert gewesen ist. König, 1,90 m groß, hager, trägt eine Augenklappe, benutzt einen Stock, weil er leicht hinkt, und hat jeden Tag damit zu kämpfen, dass noch immer „ehemalige Nazis“ an wichtigen Stellen das Sagen haben. Lou, klein, zierlich, aber zäh, hat ebenfalls im Krieg schlimme Erfahrungen machen müssen. Von ihrer ehemaligen Gruppe ist lediglich Bruno übrig geblieben, mit dem sie sich eine kleine, kalte Wohnung teilt und den sie mit durchzubringen versucht – mit den seltenen, kärglichen Honoraren, die sie mit ihren Fotos für eine Frauenzeitschrift verdient.
Zwei ganz unterschiedliche Typen, die jeder auf seine Weise dem „Jetzt“ misstrauen. Bis sie gegenseitiges Vertrauen aufbauen, dauert es dann auch eine ganze Weile. Doch König erkennt Lous Fähigkeiten, ihre Art, auf ihre Intuition zu bauen, und ihre Qualität als Fotografin. Genau das ist es, was die völlig unterversorgte, mies ausgestattete Berliner Polizei brauchen kann. Und so wird aus zwei Einzelkämpfern dann wohl ein Duo, das wir im nächsten „Fall für Lou und König“ begleiten dürfen.
Anne Stern: Die weiße Nacht
Piper, Januar 2026
400 Seiten, Hardcover, 25,00 Euro
Diese Rezension wurde verfasst von Sabine Ertz.