 Wer kennt ihn nicht, den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell, der aus Notwehr beziehungsweise auf Befehl des Landvogts Gessler mit seiner Armbrust den Apfel vom Kopf seines Sohnes schießt? Und so ihrer beiden Leben rettet. Friedrich Schiller verhalf in seinem Werk „Wilhelm Tell“ dem Schützen zu literarischem Ruhm. Das geschah im Jahr 1804. Höchste Zeit für eine Neuauflage! Helden sehen heute anders aus. Und das tun sie in Schmidts Roman. Dabei verlässt der Autor weitgehend die politische Bühne, spart Figuren und Handlungsstränge aus, die nicht unmittelbar mit Tell zu tun haben. Hier werden keine Allianzen unter Aufständischen geschmiedet, keine Reden geschwungen. Schmidt konzentriert sich auf die menschlich-psychologische Ebene, auf Tells unmittelbares Umfeld. Die Menschen, die ihn kennen und mit denen sich sein Schicksal kreuzt. Als stilistischen Spannungs-Booster wechselt Schmidt dabei ständig die Perspektive. Wir erleben die Geschehnisse durch die Augen von rund 20 verschiedenen Personen, die in kurzen, jeweils ein bis vier Seiten langen Passagen die einzelnen Vorkommnisse schildern. Daraus entwickelt sich ein sehr mitreißendes Erzähltempo! Weiterlesen
Wer kennt ihn nicht, den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell, der aus Notwehr beziehungsweise auf Befehl des Landvogts Gessler mit seiner Armbrust den Apfel vom Kopf seines Sohnes schießt? Und so ihrer beiden Leben rettet. Friedrich Schiller verhalf in seinem Werk „Wilhelm Tell“ dem Schützen zu literarischem Ruhm. Das geschah im Jahr 1804. Höchste Zeit für eine Neuauflage! Helden sehen heute anders aus. Und das tun sie in Schmidts Roman. Dabei verlässt der Autor weitgehend die politische Bühne, spart Figuren und Handlungsstränge aus, die nicht unmittelbar mit Tell zu tun haben. Hier werden keine Allianzen unter Aufständischen geschmiedet, keine Reden geschwungen. Schmidt konzentriert sich auf die menschlich-psychologische Ebene, auf Tells unmittelbares Umfeld. Die Menschen, die ihn kennen und mit denen sich sein Schicksal kreuzt. Als stilistischen Spannungs-Booster wechselt Schmidt dabei ständig die Perspektive. Wir erleben die Geschehnisse durch die Augen von rund 20 verschiedenen Personen, die in kurzen, jeweils ein bis vier Seiten langen Passagen die einzelnen Vorkommnisse schildern. Daraus entwickelt sich ein sehr mitreißendes Erzähltempo! Weiterlesen
diana-wieser
Bernhard Kegel: Ausgestorbene Tiere
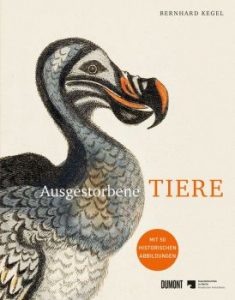 Sie heißen Lonesome George, Incas, Martha. Sie sind Endlinge. Ein Begriff, der die ganze Dramatik auf den Punkt bringt. Diese Tiere sind die letzten ihrer Art gewesen. Ausgestorben, hauptsächlich durch menschliches Zutun. Ob Dodo, Quagga, Koalalemur, Rosenkopfente, Waldrapp, Mondnagelkänguru, Bodensee-Kilch, Uraniafalter oder Pinta-Riesenschildkröte: In 50 Steckbriefen – untermalt mit herrlichen Illustrationen berühmter Naturmaler des 19. Jahrhunderts, zur Verfügung gestellt von der Staatsbibliothek Berlin – gibt der studierte Biologe Kegel dem Artensterben Gesichter. Plus dramatische Hintergrundgeschichten. Diese rufen insbesondere bei Tierfreunden Fassungslosigkeit, Trauer oder Wut hervor. Er untermauert die Schicksale mit allgemeinen Informationen zur Defaunation, Overkill-Hypothese, Koextinktion, biologischen Sonderwege auf Inseln und die Bemühungen der Forscher, ausgestorbene Arten wieder zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel durch genetische Experimente. Doch Erfolg hat bisher keine der Methoden erbracht. Damit hat das Zitat von Artur Schopenhauer leider nach wie vor nichts an Aktualität eingebüßt: „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“ Weiterlesen
Sie heißen Lonesome George, Incas, Martha. Sie sind Endlinge. Ein Begriff, der die ganze Dramatik auf den Punkt bringt. Diese Tiere sind die letzten ihrer Art gewesen. Ausgestorben, hauptsächlich durch menschliches Zutun. Ob Dodo, Quagga, Koalalemur, Rosenkopfente, Waldrapp, Mondnagelkänguru, Bodensee-Kilch, Uraniafalter oder Pinta-Riesenschildkröte: In 50 Steckbriefen – untermalt mit herrlichen Illustrationen berühmter Naturmaler des 19. Jahrhunderts, zur Verfügung gestellt von der Staatsbibliothek Berlin – gibt der studierte Biologe Kegel dem Artensterben Gesichter. Plus dramatische Hintergrundgeschichten. Diese rufen insbesondere bei Tierfreunden Fassungslosigkeit, Trauer oder Wut hervor. Er untermauert die Schicksale mit allgemeinen Informationen zur Defaunation, Overkill-Hypothese, Koextinktion, biologischen Sonderwege auf Inseln und die Bemühungen der Forscher, ausgestorbene Arten wieder zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel durch genetische Experimente. Doch Erfolg hat bisher keine der Methoden erbracht. Damit hat das Zitat von Artur Schopenhauer leider nach wie vor nichts an Aktualität eingebüßt: „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“ Weiterlesen
Adeline Dieudonné: Bonobo Moussaka
Kurz, knackig, treffsicher. Auf gerade einmal 87 Seiten schlägt die belgische Autorin Adeline Dieudonné gekonnt den Brückenschlag zwischen einer familiären Weihnachtsfeier und den Problemen der Gegenwart: von Sparpolitik, Migration, Klimakrise bis zur Ungleichverteilung der Ressourcen. Diese in Monologform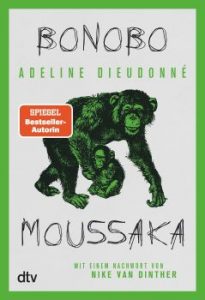 geschriebene Erzählung, von der Autorin als One-Woman-Show auf der Theaterbühne aufgeführt, legt ein ungeheures Tempo vor. Dieudonné beschönigt nichts. Doch im Gegensatz zu ihrem brutalen Erstling „Das wirkliche Leben“ wählt sie hier knochentrockenen Humor als stilistische Waffe. Mit spitzer Feder skizziert sie die Konflikte, die unter der perfekt durchchoreografierten Weihnachtsfeier lauern. Mag der Edeltropfen aus den feinen Baccarat-Champagnergläsern noch so vorzüglich munden – in Wirklichkeit liegt alles in Scherben. Während wir nur einen Wimpernschlag von unseren affenartigen Verwandten, den Bonobos, entfernt sind.
geschriebene Erzählung, von der Autorin als One-Woman-Show auf der Theaterbühne aufgeführt, legt ein ungeheures Tempo vor. Dieudonné beschönigt nichts. Doch im Gegensatz zu ihrem brutalen Erstling „Das wirkliche Leben“ wählt sie hier knochentrockenen Humor als stilistische Waffe. Mit spitzer Feder skizziert sie die Konflikte, die unter der perfekt durchchoreografierten Weihnachtsfeier lauern. Mag der Edeltropfen aus den feinen Baccarat-Champagnergläsern noch so vorzüglich munden – in Wirklichkeit liegt alles in Scherben. Während wir nur einen Wimpernschlag von unseren affenartigen Verwandten, den Bonobos, entfernt sind.
Die Ich-Erzählerin ist 36 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Die Erkenntnis, in was für eine schreckliche Welt sie ihren Nachwuchs gesetzt hat, überfällt sie mit ungeheurer Wucht. Die Weihnachtsfeier im Haus ihres Cousins macht die Sache nicht besser. Weiterlesen
Christiane Tramnitz: Das Dorf und der Tod
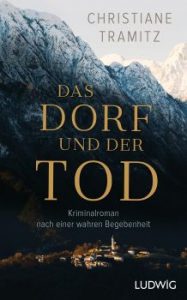 Eine True-Crime-Story aus Oberbayern, deren unheilvolle Wurzeln bis ins Jahr 1921 zurückreichen. Nicht erst seit Romanen wie „Das finstere Tal“ von Thomas Willmann wissen wir, dass es im abgeschiedenen Mikrokosmos der Bergwelten um die Frauenrechte meist nicht zum Besten stand. Mein Körper gehört mir? Fehlanzeige. Diese bittere Erfahrung muss auch die achtzehnjährige Dorfschönheit Vroni machen, die von „Hallodri“ und Revolutionär Lorenz kurz nach dem Ersten Weltkrieg schwanger wird. Um einen Skandal zu vermeiden, greifen ihre Eltern zu drastischen Maßnahmen. Die böse Saat des Verderbens ist gesät. Doch sie reift erst Generationen später zu den Früchten des Zorns heran und entlädt sich im Jahr 1995 in einer ungeheuerlichen Tat. Autorin Christiane Tramnitz ist selbst in diesem bayerischen Dorf aufgewachsen und rollt den Fall aus verschiedenen Perspektiven auf, wobei ihr ihre Erfahrungen als promovierte Verhaltensforscherin zugutekommen. Das Resultat ist kein Krimi im eigentlichen Sinn. Sondern eine spannende Universalgeschichte, die der Gesellschaft zwischen zwei Weltkriegen den Spiegel vorhält. Denn auch außerhalb von Vronis persönlichem Unglück wimmelt es von Tragödien. Die Verlierer des ersten Weltkrieges – arme, von den „Judenbanken“ ausgeblutete Bauern – werden zu radikalen Vorreitern der NSDAP. Helfer, Mitläufer, Geflüchtete, Widerständler, Opfer und Täter kristallisieren sich immer mehr im Verlauf des Plots heraus. Von klein an zu Gehorsam erzogen, von Eltern und Kirche der eigenen Stimme beraubt, wächst eine Generation heran, die nicht gelernt hat, für eigene oder die Rechte anderer einzutreten. Weiterlesen
Eine True-Crime-Story aus Oberbayern, deren unheilvolle Wurzeln bis ins Jahr 1921 zurückreichen. Nicht erst seit Romanen wie „Das finstere Tal“ von Thomas Willmann wissen wir, dass es im abgeschiedenen Mikrokosmos der Bergwelten um die Frauenrechte meist nicht zum Besten stand. Mein Körper gehört mir? Fehlanzeige. Diese bittere Erfahrung muss auch die achtzehnjährige Dorfschönheit Vroni machen, die von „Hallodri“ und Revolutionär Lorenz kurz nach dem Ersten Weltkrieg schwanger wird. Um einen Skandal zu vermeiden, greifen ihre Eltern zu drastischen Maßnahmen. Die böse Saat des Verderbens ist gesät. Doch sie reift erst Generationen später zu den Früchten des Zorns heran und entlädt sich im Jahr 1995 in einer ungeheuerlichen Tat. Autorin Christiane Tramnitz ist selbst in diesem bayerischen Dorf aufgewachsen und rollt den Fall aus verschiedenen Perspektiven auf, wobei ihr ihre Erfahrungen als promovierte Verhaltensforscherin zugutekommen. Das Resultat ist kein Krimi im eigentlichen Sinn. Sondern eine spannende Universalgeschichte, die der Gesellschaft zwischen zwei Weltkriegen den Spiegel vorhält. Denn auch außerhalb von Vronis persönlichem Unglück wimmelt es von Tragödien. Die Verlierer des ersten Weltkrieges – arme, von den „Judenbanken“ ausgeblutete Bauern – werden zu radikalen Vorreitern der NSDAP. Helfer, Mitläufer, Geflüchtete, Widerständler, Opfer und Täter kristallisieren sich immer mehr im Verlauf des Plots heraus. Von klein an zu Gehorsam erzogen, von Eltern und Kirche der eigenen Stimme beraubt, wächst eine Generation heran, die nicht gelernt hat, für eigene oder die Rechte anderer einzutreten. Weiterlesen
Vicky Baum: Zwischenfall im Lohwinckel (1930)
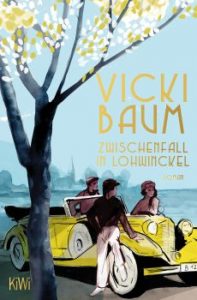 Grandiose Beobachtungsgabe, geschrieben mit spitzer Feder und ebenso humoristischen Spitzen: Vicki Baum, deren wunderbare Gesellschaftsromane einst den Nazis zum Opfer fielen, ist eine lohnenswerte literarische Wiederentdeckung! In ihrem Buch lässt sie Lebensmodelle, Milieus und Menschen aufeinander krachen, dass es eine Lust zu lesen ist! Unterhaltsam, aber mit Tiefgang, dabei von verblüffender Aktualität. Kurz: Die Zutaten, aus dem Klassiker gemacht sind.
Grandiose Beobachtungsgabe, geschrieben mit spitzer Feder und ebenso humoristischen Spitzen: Vicki Baum, deren wunderbare Gesellschaftsromane einst den Nazis zum Opfer fielen, ist eine lohnenswerte literarische Wiederentdeckung! In ihrem Buch lässt sie Lebensmodelle, Milieus und Menschen aufeinander krachen, dass es eine Lust zu lesen ist! Unterhaltsam, aber mit Tiefgang, dabei von verblüffender Aktualität. Kurz: Die Zutaten, aus dem Klassiker gemacht sind.
Im verschlafenen Städtchen Lohwinckel in Rheinhessen geht in den ausklingenden 20er Jahren alles seinen gewohnten Gang. Bis drei mondäne Berliner mit ihrem Auto im Straßengraben landen, ärztlich versorgt werden müssen und bei der hiesigen Bevölkerung zur Genesung einquartiert werden. Das Trio infernale bringt im Ort alles durcheinander. Da ist die attraktive Leore Lania, Filmschauspielerin und vierfach geschieden, die mit ihrem neuen Lover Peter Karbon – Industrieller, Lebemann, Freigeist – durch die Lande tingelt. Dazu der Mittelgewichtsweltmeister im Boxen, Franz Albrecht, dessen maskuliner Körper so gar nicht mit seinem zartbesaiteten Verhalten übereinstimmen will. Kaum treffen die fortschrittlich gestimmten Berliner auf die konservativen Provinzler, brechen die unter der Oberfläche brodelnden Konflikte hervor: Arbeiterstreiks, amouröse Verwicklungen, alte Fehden, jugendliche Aufstände und medizinische Streitfragen verwandeln Lohwinckel in ein Pulverfass, dass sich in einem tatsächlichen Brand entlädt. Weiterlesen
Denis Scheck & Christina Schenk: Der undogmatische Hund
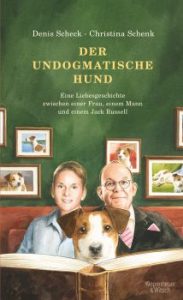 Wau oder Wow – das ist hier die Frage! Denis Scheck, aufgrund seiner gewitzten und scharfzüngigen Art momentan wohl Deutschlands beliebtester Literaturkritiker, präsentiert sich hier von einer völlig neuen Seite: als Hundebesitzer seines Jack Russell-Terriers „Stubbs“. Gemeinsam mit seiner Frau Christina Schenk, einer Kulturredakteurin, hat er eine hinreißende Liebeserklärung an sein vierbeiniges Familienmitglied geschrieben. Natürlich wäre Scheck nicht Scheck, wenn er sich hierfür nicht ein paar literarische Finessen hätte einfallen lassen. Neben der erzählerischen Ebene, in der das Ehepaar von seinen Erlebnissen zwischen Hundeschule, Turnierplatz und turbulenten Reisen berichtet, kommt auch Stubbs selbst zu Wort. In seinem „caniden Kanon“ stellt Stubbs elf herausragende Hunde der Weltliteratur vor. Gesehen aus den Augen des Vierbeiners, geschrieben im Kölscher Dialekt, was für Leser außerhalb des Ruhrgebietes durchaus anspruchsvoll sein kann. Doch schließlich dreht der quirlige Jack Russell seine Gassi-Runden in der Karnevalsmetropole am Rhein. Wem Begriffe wie „Rampelsant“ und „schisskojenno“ nichts sagen, findet im hinteren Teil des Buches dankeswerterweise ein Glossar „Ruhrdeutsch – Deutsch“. Weiterlesen
Wau oder Wow – das ist hier die Frage! Denis Scheck, aufgrund seiner gewitzten und scharfzüngigen Art momentan wohl Deutschlands beliebtester Literaturkritiker, präsentiert sich hier von einer völlig neuen Seite: als Hundebesitzer seines Jack Russell-Terriers „Stubbs“. Gemeinsam mit seiner Frau Christina Schenk, einer Kulturredakteurin, hat er eine hinreißende Liebeserklärung an sein vierbeiniges Familienmitglied geschrieben. Natürlich wäre Scheck nicht Scheck, wenn er sich hierfür nicht ein paar literarische Finessen hätte einfallen lassen. Neben der erzählerischen Ebene, in der das Ehepaar von seinen Erlebnissen zwischen Hundeschule, Turnierplatz und turbulenten Reisen berichtet, kommt auch Stubbs selbst zu Wort. In seinem „caniden Kanon“ stellt Stubbs elf herausragende Hunde der Weltliteratur vor. Gesehen aus den Augen des Vierbeiners, geschrieben im Kölscher Dialekt, was für Leser außerhalb des Ruhrgebietes durchaus anspruchsvoll sein kann. Doch schließlich dreht der quirlige Jack Russell seine Gassi-Runden in der Karnevalsmetropole am Rhein. Wem Begriffe wie „Rampelsant“ und „schisskojenno“ nichts sagen, findet im hinteren Teil des Buches dankeswerterweise ein Glossar „Ruhrdeutsch – Deutsch“. Weiterlesen
Monika Helfer: Die Bagage
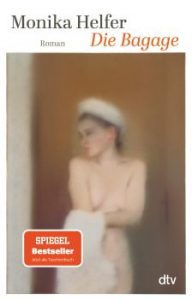 Ein kraftvolles, autobiografisches Familienepos – ausgezeichnet mit dem Schubart-Literaturpreis 2021 der Stadt Aalen – das mit vielen stilistischen Konventionen bricht. Auf 160 Seiten, für ein generationenübergreifendes Familiendrama eigentlich undenkbar gestrafft, verdichtet die Autorin meisterhaft Themen wie Habgier, Neid, Rache, Lust, die gleichzeitige Faszination und Angst vor dem Fremden, zu einem fast schon universellen Gleichnis über Ausgrenzung.
Ein kraftvolles, autobiografisches Familienepos – ausgezeichnet mit dem Schubart-Literaturpreis 2021 der Stadt Aalen – das mit vielen stilistischen Konventionen bricht. Auf 160 Seiten, für ein generationenübergreifendes Familiendrama eigentlich undenkbar gestrafft, verdichtet die Autorin meisterhaft Themen wie Habgier, Neid, Rache, Lust, die gleichzeitige Faszination und Angst vor dem Fremden, zu einem fast schon universellen Gleichnis über Ausgrenzung.
Die „Bagage“ steht für Gesindel, Pack, für eine Gruppe von wenig wertgeschätzten Personen, meist verarmten Familien mit schlechtem Ruf. Eine solche lebt am hinteren Ende eines abgelegenen österreichischen Tals nahe des Bodensees. Die Familie ist von Anfang an auf der Schattenseite des Lebens verortet. Sprichwörtlich, denn die Bergmassive lassen kein Licht auf den Hof und die kargen Felder. Die biblischen Vornamen Maria und Josef nutzen den Eheleuten wenig. Zu ihrer Armut kommen noch weitere Aspekte, die sie einzigartig machen: Beide sind außergewöhnlich schön. Mit ihren schwarzen Haaren, der weißen Haut sowie ihrem ausgeprägten Sinn für Reinlichkeit, unterscheiden sie sich wesentlich von der kränklichen, stinkend-schmutzigen Dorfbevölkerung. Ein Grund, warum sich der Bürgermeister am liebsten mit Josef umgibt. Weiterlesen
Barbara Pym: Quartett im Herbst (1977)
Vier Arbeitskollegen straucheln im „Herbst“ ihres Lebens – oder vielmehr kurz vor der Rente. Wie kaum eine andere versteht es die englische Autorin Barbara Pym sarkastische Spitzen und leise Untertöne, Humor und Tragik so gekonnt zu vermischen. Ihre vier unterschiedlichen Charaktere skizziert sie haargenau. Die Figuren blitzen so lebhaft vor unserem inneren Auge auf, als würden sie uns bei einem Earl Grey auf dem Sofa gegenübersitzen. Die Autorin staffiert jede einzelne mit ebenso liebenswerten wie skurrilen Eigenheiten aus. Edwin, Norman, Letty und Marcia sind zwar grundverschieden, dennoch verbindet sie mehr als nur ihre Arbeit in d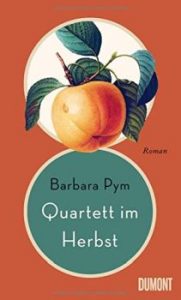 er Abteilung einer Londoner Firma. Alle vier sind alleinstehend, einsam und wissen nicht, womit sie die langen Tage abseits des Büros füllen sollen. Oder wie Norman sich angesichts der gefürchteten Ferienzeit eingestehen muss: „Ein paar Urlaubstage hatte er noch in der Hinterhand. ‚Man weiß nie, wozu so etwas gut sein kann‘, sagte er, aber er argwöhnte selbst, dass ihm diese Reservetage nie zu etwas gut sein würden, sondern sich vor ihm ansammeln würden wie die Haufen toten Laubs, die im Herbst auf die Gehsteige geweht wurden.“ (S. 60)
er Abteilung einer Londoner Firma. Alle vier sind alleinstehend, einsam und wissen nicht, womit sie die langen Tage abseits des Büros füllen sollen. Oder wie Norman sich angesichts der gefürchteten Ferienzeit eingestehen muss: „Ein paar Urlaubstage hatte er noch in der Hinterhand. ‚Man weiß nie, wozu so etwas gut sein kann‘, sagte er, aber er argwöhnte selbst, dass ihm diese Reservetage nie zu etwas gut sein würden, sondern sich vor ihm ansammeln würden wie die Haufen toten Laubs, die im Herbst auf die Gehsteige geweht wurden.“ (S. 60)
Die menschenscheue Marcia hat eine Marotte: Sie sammelt Milchflaschen und Konservendosen, um sie ständig neu zu sortieren, während Haushalt und Garten verwildern. Seit ihrer Mastektomie schwärmt sie für ihren Chirurgen Dr. Strong. Die Kontrolluntersuchungen werden zum sozialem Highlight. Obendrein sticht sie durch einen ziemlich schrillen Modegeschmack, beziehungsweise durch Fehlen desselben, ins Auge. Weiterlesen
Franz Hohler: Der Enkeltrick
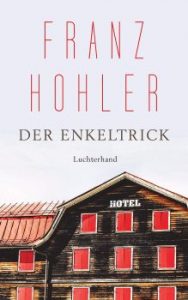 Die elf Erzählungen des Schweizer Autors sind wie die Alpen, die in seinen Werken häufig eine Rolle spielen. Von starker Substanz und solider Schönheit, strömt das Zufällige oder eben nicht Zufällige, das alltäglich Wahnsinnige und Unerklärliche ganz luzide-leicht durch Schluchten und Klämme in den Plot hinein. Stets streift der Autor gekonnt das Phantastische, bleibt dabei aber im Bereich des Möglichen. So wohnt jeder Erzählung ein ganz besonderes Überraschungsmoment inne. Mal erwischt uns der Autor eiskalt, mal spielt er mit unseren Erwartungen, um sie in denkbar gegenteiliger Art aufzulösen. Scheinbar Harmloses entpuppt als doppelbödig, während offenbar Wundersames als Fälschung entlarvt wird. So oder so: Franz Hohlers Geschichten sind ein literarisches Happening. Aber nach 160 Seiten leider viel zu schnell vorbei.
Die elf Erzählungen des Schweizer Autors sind wie die Alpen, die in seinen Werken häufig eine Rolle spielen. Von starker Substanz und solider Schönheit, strömt das Zufällige oder eben nicht Zufällige, das alltäglich Wahnsinnige und Unerklärliche ganz luzide-leicht durch Schluchten und Klämme in den Plot hinein. Stets streift der Autor gekonnt das Phantastische, bleibt dabei aber im Bereich des Möglichen. So wohnt jeder Erzählung ein ganz besonderes Überraschungsmoment inne. Mal erwischt uns der Autor eiskalt, mal spielt er mit unseren Erwartungen, um sie in denkbar gegenteiliger Art aufzulösen. Scheinbar Harmloses entpuppt als doppelbödig, während offenbar Wundersames als Fälschung entlarvt wird. So oder so: Franz Hohlers Geschichten sind ein literarisches Happening. Aber nach 160 Seiten leider viel zu schnell vorbei.
Allein schon die titelgebende Einstiegsgeschichte hat es in sich. Sie beginnt, wie vermutet, mit einer dementen Dame, die von einer Trickbetrügerin hereingelegt werden will. Doch die Geschichte nimmt eine völlig unerwartete Wendung. Denn es ist gerade die Demenz und gar das vereitelte Verbrechen, welches Amalie zu einem Abenteuer verhilft. Zu einem Traum, den sie sich klaren Verstandes nie hatte verwirklichen können. Dieser Plot-Twist kommt so federleicht daher, so natürlich, dass wir dem Autor ganz selbstverständlich durch die Geschichte folgen. Weiterlesen
Imbolo Mbue: Wie schön wir waren
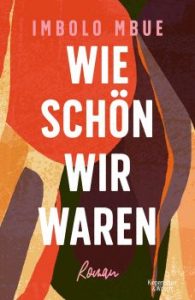 Eine überaus kraftvolle Geschichte – ergreifend, bewegend, aufrüttelnd: Die Bewohner des afrikanischen Dorfes Kosawa sind die stolzen Nachfahren des „Leopardenblutes“. Sie leben mit ihren sieben Schwesterndörfern im Einklang mit der Natur. Bis die amerikanische Ölbohrfirma Pexton kommt. Der Diktator des Landes gibt dem Unternehmen das Land, um dort nach dem Schwarzen Gold zu bohren. Öl und Giftmüll fließen fortan ungeklärt in Boden und Wasser. Kinder werden krank und sterben, die Äcker geben keine Ernte mehr her, selbst Heilkräuter verdorren. Die Firma verspricht zu helfen, doch nichts passiert. Alle Bemühungen, sich gegen die Ungerechtigkeit aufzulehnen, werden durch Regierungssoldaten gewaltsam beantwortet. Massaker, Hinrichtungen und Verhaftungen sind die Folge. Die Bewohner hoffen auf die Unterstützung durch Hilfsorganisationen. Doch Pexton hat Geld, der Diktator Beziehungen. Der Frust entlädt sich in der nachfolgenden Generation und deren Leitfigur: Thula, deren Vater einst hingerichtet wurde, studiert in New York. Dort kommt sie mit Protestbewegungen in Berührung. Sie hat eine Vision, ihr Heimatland friedlich zu reformieren. Ihre Freunde in Kusawa drängt es allerdings zu einer blutigen Revolution. „Aber welche Wahl haben wir in einer Welt, in der viele glauben, ihr eigenes Glück hänge vom Unglück anderer ab.“ (S. 103) Weiterlesen
Eine überaus kraftvolle Geschichte – ergreifend, bewegend, aufrüttelnd: Die Bewohner des afrikanischen Dorfes Kosawa sind die stolzen Nachfahren des „Leopardenblutes“. Sie leben mit ihren sieben Schwesterndörfern im Einklang mit der Natur. Bis die amerikanische Ölbohrfirma Pexton kommt. Der Diktator des Landes gibt dem Unternehmen das Land, um dort nach dem Schwarzen Gold zu bohren. Öl und Giftmüll fließen fortan ungeklärt in Boden und Wasser. Kinder werden krank und sterben, die Äcker geben keine Ernte mehr her, selbst Heilkräuter verdorren. Die Firma verspricht zu helfen, doch nichts passiert. Alle Bemühungen, sich gegen die Ungerechtigkeit aufzulehnen, werden durch Regierungssoldaten gewaltsam beantwortet. Massaker, Hinrichtungen und Verhaftungen sind die Folge. Die Bewohner hoffen auf die Unterstützung durch Hilfsorganisationen. Doch Pexton hat Geld, der Diktator Beziehungen. Der Frust entlädt sich in der nachfolgenden Generation und deren Leitfigur: Thula, deren Vater einst hingerichtet wurde, studiert in New York. Dort kommt sie mit Protestbewegungen in Berührung. Sie hat eine Vision, ihr Heimatland friedlich zu reformieren. Ihre Freunde in Kusawa drängt es allerdings zu einer blutigen Revolution. „Aber welche Wahl haben wir in einer Welt, in der viele glauben, ihr eigenes Glück hänge vom Unglück anderer ab.“ (S. 103) Weiterlesen