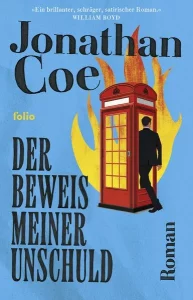Christopher Swann, linksliberaler Blogger, macht sich auf den Weg zu einem Kongress der TrueCon-Bewegung, einer Sammlung von radikalen Marktwirtschaftlern und rechtsorientierten Politikern, Professoren und Unternehmern, um deren finstere Machenschaften aufzudecken. Das Luxushotel in den malerischen südenglischen Cotswolds verlässt er nicht mehr lebend.
Wer – und warum – tötete ihn mit elf Stichen eines japanischen Küchenmessers? Schnell finden sich mehrere Tatverdächtige inklusive Motiv. Spuren in die Vergangenheit deuten möglicherweise auf einen zweiten Mord hin. An dieser Stelle spielt Coe, teilweise ironisch, mit verschiedenen Versatzstücken des Genres: Es gibt einen Locked Room, einen Geheimgang, eine alkoholaffine, kurz vor der Pensionierung stehende Kommissarin (immerhin mal eine Frau) und eine kryptische Botschaft des Opfers.
Hört sich nach einem Kriminalroman an, ist aber eigentlich keiner, bzw. nur am Rande. Eher handelt es sich um eine literarische Stilübung. Für einen Krimi ist der Einstieg viel zu langatmig. Später zeigt sich, dass die ersten rund 50 Seiten nicht der Spannungserzeugung dienen, sondern der Vorbereitung der Leser sowohl auf die literarische Form als auch auf die doppelt überraschende Auflösung der Rätsel am Ende des Romans.
Eingerahmt vom Prolog – in dem wir Phil Maidstone, literarisch ambitionierte Tochter einer früheren Freundin Swanns, und Rashida Swann, Chris‘ Adoptivtochter, kennenlernen – und dem alles auflösenden Epilog besteht der Hauptteil aus drei Kapiteln ganz unterschiedlicher Erzählformen und Genres.
Der erste Teil entspricht formal dem traditionellen cosy crime. Chris ist an brisantes Material gekommen, das für die Hintermänner des Kongresses gefährlich werden könnte, insbesondere an einen Geheimplan, den britischen National Health Service aufzulösen und das Gesundheitssystem komplett zu privatisieren. Bevor er das Material veröffentlichen kann, wird Chris ermordet. Eine Kommissarin, Detective Inspector Freeborne, beginnt zu ermitteln. Es folgen diverse Vernehmungen, in denen sich alle verdächtig machen, Spuren werden ausgewertet und interpretiert. Rätsel über Rätsel.
Der zweite Teil springt weit in die Vergangenheit zurück und hat auf den ersten Blick nicht viel mit dem Mordfall zu tun. Es handelt sich um eine vor allem im englischen Sprachraum beliebte Dark-Academia-Story, also um einen Universitätsroman mit Thriller-Elementen, mit skurrilen Charakteren und klandestinen Klubs mit seltsamen Riten.
Zusammen mit DI Freeborne lesen wir ein Memoir, das im Laufe der Ermittlungen aufgetaucht ist. Brian Collier, ehemaliger Kommilitone und Freund des Mordopfers, schildert die Ereignisse der gemeinsamen Studienjahre, die Studenten und Dozenten und die Thatcher-begeisterte Atmosphäre der frühen 1980er Jahre.
Der dritte Teil kehrt in Form eines autofiktionalen Essays zum Mordfall zurück, wobei es sich gleich um zwei Erzählerinnen handelt. Die im Prolog eingeführten Phil und Rashida haben beschlossen, auf eigene Faust zu ermitteln. Nicht ganz zufällig begegnen sie DI Freeborne, und zu dritt wird der Fall gelöst.
Dann jedoch folgt der Epilog. Dessen erneute Wendung natürlich verschwiegen werden muss.
Und was ergibt sich aus all dem? Nun, den begeisterten Kommentaren des Klappentextes vermag ich nur eingeschränkt zuzustimmen. Alle Teile separat betrachtet machen Sinn, sind flüssig und anregend geschrieben, voller interessanter, kritischer Gedanken zur heutigen und damaligen politischen Situation (nicht umsonst umfasst die Erzählzeit exakt die 49 Tage der Regierungszeit von Liz Truss). Über den Roman verstreut beschäftigt sich Coe mit, wie man heute sagt, diversen Mindsets, mit der Gedankenwelt der Boomer, der Gen Z, des radikalen Wirtschaftsliberalismus, der britischen Bildungs- und Wirtschaftseliten. Dann wiederum finden sich Kommentare zur Schwierigkeit, Fiktion und Realität auseinanderzuhalten, zu Covid und Klimawandel und ihren Leugnern.
Die angekündigte Satire konnte ich nicht entdecken. Gelegentliche ironische Anmerkungen, insbesondere im zweiten Teil, reichen da nicht. Gerade die Beschreibung des elitären Uni-Personals hätte, um dieses Prädikat zu verdienen, deutlich bissiger und pointierter sein müssen.
Lesenswert ist Coes Roman allemal. Ob die wechselnden Genres, die unzähligen Abschweifungen und Anekdoten sich allerdings zu einem schlüssigen oder gar »brillanten« (so ein Kommentar auf dem Cover) Gesamteindruck zusammenfügen, das dürfte mancher Leser anders sehen.
Jonathan Coe: Der Beweis meiner Unschuld.
Aus dem Englischen übersetzt von Cathrine Hornung.
Folio Verlag, August, 2025.
416 Seiten, Taschenbuch, 28,00 €
Diese Rezension wurde verfasst von Wolfgang Mebs.