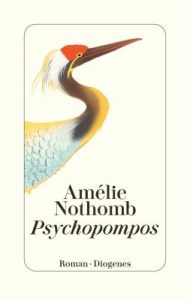 In diesem Werk, einer Mischung aus Autobiografie, spirituellen Erkenntnissen und Schreibfindungsprozess, gewährt uns die vielfach prämierte Autorin Amélie Nothomb faszinierende Einblicke in ihr Leben. Als Diplomatentochter lebte sie in ihrer Kindheit unter anderem in Japan, China, New York, Bhutan und Bangladesch. Amélie Nothomb, die ständig Entwurzelte, findet in den Vögeln ihre Seelentiere. Sie identifiziert sich mit ihrem Wesen, auch und gerade nach einem persönlichen Trauma zu Beginn ihrer Pubertät. Doch hinter ihrer Passion für Vögel steckt weit mehr als ornithologische Hingabe. Ihre Faszination gilt Psychopomp, einem Wesen, das die Seelen der Toten ins Jenseits begleitet. Mal kann dies ein Götterbote wie Hermes sein, mal ein Vogel wie die Taube in der Bibel als Symbol des Heiligen Geistes. Poetisch, mit leisem Humor, aber auch düster und abstrakt ist der Autorin ein faszinierendes Konglomerat an Stilen gelungen, das der Begriff Biografie allein nicht zu fassen vermag. Wer sich auf dieses ungewöhnliche Leseerlebnis einlassen kann, wird nicht enttäuscht. Denn dies ist keine Biografie im herkömmlichen Sinn.
In diesem Werk, einer Mischung aus Autobiografie, spirituellen Erkenntnissen und Schreibfindungsprozess, gewährt uns die vielfach prämierte Autorin Amélie Nothomb faszinierende Einblicke in ihr Leben. Als Diplomatentochter lebte sie in ihrer Kindheit unter anderem in Japan, China, New York, Bhutan und Bangladesch. Amélie Nothomb, die ständig Entwurzelte, findet in den Vögeln ihre Seelentiere. Sie identifiziert sich mit ihrem Wesen, auch und gerade nach einem persönlichen Trauma zu Beginn ihrer Pubertät. Doch hinter ihrer Passion für Vögel steckt weit mehr als ornithologische Hingabe. Ihre Faszination gilt Psychopomp, einem Wesen, das die Seelen der Toten ins Jenseits begleitet. Mal kann dies ein Götterbote wie Hermes sein, mal ein Vogel wie die Taube in der Bibel als Symbol des Heiligen Geistes. Poetisch, mit leisem Humor, aber auch düster und abstrakt ist der Autorin ein faszinierendes Konglomerat an Stilen gelungen, das der Begriff Biografie allein nicht zu fassen vermag. Wer sich auf dieses ungewöhnliche Leseerlebnis einlassen kann, wird nicht enttäuscht. Denn dies ist keine Biografie im herkömmlichen Sinn.
Von der Kranichfrau zum Seelenbegleiter
Andere Kinder lauschen Dornröschen und Aschenputtel, doch Amélie Nothomb ist als Kind von dem traditionellen japanischen Märchen rund um die „Kranichfrau“ fasziniert, die Nacht für Nacht aus ihren eigenen Federn die schönsten Stoffe webt. Womit ihr Mann, ein Textilhändler, zu Reichtum kommt, letztendlich aber seiner Gier erliegt. Egal, in welchem Land sich die junge Amélie auch aufhält, Vögel sind ihre Leidenschaft. Frühmorgens liegt sie bereits wach im Bett und kann einzelne Charaktere an ihrer Stimme erkennen. Die erste Hälfte des Buches ist gespickt mit Rückblenden und Anekdoten der altklugen Amelie, welche die Umstände ihrer Adoleszenz hinreißend trocken auf den Punkt bringt. Beispiel: „Ich wurde zwölf. Das ärgerte mich, weil es nichts Gutes verhieß. In Bangladesch wurden Mädchen in meinem Alter verheiratet.“ (S.56)
Leiste Ironie, lebendige Bilder, spirituelle Ansätze
Doch mit Beginn der Pubertät erleidet die Autorin ein lebensveränderndes Trauma, das sie lange verfolgen wird. Sie zieht sich in sich selbst zurück, fühlt sich vom Tod angezogen, durchlebt Phasen der Anorexie, ebenso wie die Phasen ihrer ersten Schreibversuche. Denn sie erkennt, dass sie auch durch das Schreiben, fliegen, abstürzen und sich verwandeln kann. Im zweiten Teil wird das Buch immer abstrakter, spiritueller und für manche LeserInnen sicherlich auch „verrückter“. Nothomb beschließt, dass ein Psychopomp auch ihrer Lebensaufgabe entspricht. Selbst die dunkelsten Abgründe ihrer Existenz weiß die Autorin mit ironischen Spitzen zu versehen, was sicherlich dazu geeignet ist, eine gewisse nötige Distanz zu dem (Wieder-) Durchlebten aufzubauen. „Denjenigen, die sich angesichts meines Größenwahns die Augen reiben, sei gesagt, als Baby war ich noch radikaler. Ich hielt mich für Gott. Dass ich mich mit dreizehn dazu herabließ, nur der Heilige Geist zu sein, bewies eine langsame, aber stetige Entwicklung zu etwas mehr Bescheidenheit.“ (S.69).
Ihre Rolle als Psychopomp und ihr Schreiben, teils als verlängertes Sprachrohr der Toten (wir ihrem Vater)– all dies bietet Wissenswertes über die Entstehungsgeschichten von einigen von Nothombs Romanen. Für Fans der Autorin daher ein Muss. Wer mit spirituellen Ansätzen nichts anzufangen weiß, dürfte zum zweiten Teil des Buches jedoch nur schwerlich einen Zugang finden. Alle anderen werden Nothombs Schreibbiografie mit Staunen verfolgen. Und zu Vogelfans werden. Falls Sie es nicht schon längst sind.
Amélie Nothomb: Psychopompos
Diogenes, Juni 2025
128 Seiten, Gebundene Ausgabe, 23,00 Euro
Diese Rezension wurde verfasst von Diana Wieser.