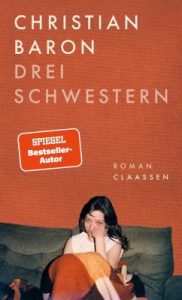 Der deutsche Autor Christian Baron (Jahrgang 1985) hat eine Trilogie zu seiner Familiengeschichte geschrieben. Der erste Teil „Ein Mann seiner Klasse“ (2020) wurde hochgelobt und unter der Regie von Marc Brummund 2024 verfilmt. Darin erzählt Christian Baron seine eigene und die Geschichte seiner Eltern Mira und Ottes in den 1990er Jahren. Im zweiten Teil „Schön ist die Nacht“ (2022) stehen Barons Großeltern in den 1970er Jahren im Mittelpunkt. Nun kommt mit „Drei Schwestern“ der Mittelteil aus den 1980er Jahren an die Öffentlichkeit. Am 31. Juli 2025 erschien der Roman im Claassen Verlag.
Der deutsche Autor Christian Baron (Jahrgang 1985) hat eine Trilogie zu seiner Familiengeschichte geschrieben. Der erste Teil „Ein Mann seiner Klasse“ (2020) wurde hochgelobt und unter der Regie von Marc Brummund 2024 verfilmt. Darin erzählt Christian Baron seine eigene und die Geschichte seiner Eltern Mira und Ottes in den 1990er Jahren. Im zweiten Teil „Schön ist die Nacht“ (2022) stehen Barons Großeltern in den 1970er Jahren im Mittelpunkt. Nun kommt mit „Drei Schwestern“ der Mittelteil aus den 1980er Jahren an die Öffentlichkeit. Am 31. Juli 2025 erschien der Roman im Claassen Verlag.
Der Roman „Drei Schwestern“ von Christian Baron ist enttäuschend
Ich möchte vorausschicken, dass ich die ersten beiden Romane der Trilogie von Christian Baron nicht gelesen habe. Der Film „Ein Mann seiner Klasse“ hat mich beeindruckt und war auch der Grund „Drei Schwestern“ zu lesen. Nun, was soll ich über das Buch sagen? In erster Linie hat es mich enttäuscht. Die Familiengeschichte von Christian Baron ist ganz sicher erzählenswert, jedoch scheint mir „Drei Schwestern“ nicht sehr gut gelungen. Und das liegt vor allem daran, dass sich die Geschichte von Mira, Christians Mutter, und ihren beiden Schwestern konstruiert und wenig glaubhaft liest. Barons Dialoge sind oft ausschweifend lang, wirken aufgesetzt und unecht. Zusammengeschustert kam mir beim Lesen in den Sinn.
Dabei wäre in der Geschichte um Juli, Mira und Ella genügend Zündstoff und Dramatik enthalten. Aber zunächst zum Inhalt: Mira erleidet mit sechzehn 1979 eine Totgeburt. Gerade erst ist ihre eigene Mutter an Krebs gestorben. Sie wurde nur dreiundfünfzig Jahre alt. Mira trauert um das Kind, dessen Vater, ein italienischer Junge mit seinen Eltern nach Italien zurückgekehrt ist. Mira hat alles satt: die Familie, die Schule, die Stadt. Sie reißt aus nach West-Berlin. Dort arbeitet sie als Putzfrau und ärgert sich über die verwöhnten Mittelstands-Kinder, die sich ihr Studentenleben und ihr Protestgehabe von den Eltern oder dem Sozialamt finanzieren lassen.
Derweil versuchen ihre Schwestern Ella und Juli, mit Hilfe von Miras Freund Ottes, Mira zur Rückkehr nach Kaiserslautern zu bewegen. Ella ist sehr viel älter als Juli und Mira und hat ihren sozialen Aufstieg durch Heirat geschafft. Aber sie trägt auch die Last ihrer Herkunftsfamilie mit sich und die Verantwortung für ihre jüngeren Schwestern. Juli ist rebellisch und hasst Ottes. Sie glaubt, dass Mira „mehr kann“. Vater Willy und Oma Hulda bilden den mehr oder weniger funktionierenden erzieherischen Rahmen für Mira und Juli. Später kehrt Mira zurück, kommt mit Ottes zusammen, wird schwanger und will ihn heiraten. Juli und Ella wollen das weiter verhindern, scheitern jedoch am Ende. Juli eröffnet mit ihrem Freund Ralf eine Videothek. Und Ella verleugnet ihre Schwestern im Theater, in dem sie sich ausgerechnet Tschechows „Drei Schwestern“ ansehen, gegenüber einer Bekannten aus ihrer „neuen“ Klasse.
Barons „Drei Schwestern“ als Reminiszenz an Tschechows „Drei Schwestern“?
Von Beginn des Romans an ärgere ich mich über Barons Milieuzeichnung, über seine Dialoge und über die Einbettung in die Zeit. Und da sind es vor allem die Musiktitel und -zitate, z.B. Bob Marley und Blauer Bock, die für das Zeitkolorit herhalten müssen. Christian Barons Beschreibungen der West-Berliner Szene gleichen einer Karikatur. Und seine Zeichnungen Kaiserslauterer Problemviertel sind sprachlich ziemlich schwach und sehr holprig geraten: „Fast keine Fensterscheibe gab es hier ohne Risse, die Mauern waren verblasst und verwittert, die Türpfosten und Fensterrahmen zerbrochen und lose, die Briefkästen verschmiert und zerbeult. Der Abend war schon nicht mehr ganz so jung. Aus allen Ecken schossen die Blicke auf Juli, die Augen der Bewohner schienen zu funkeln. Am Himmel standen bläuliche Nachtwolken, wobei sie eher tief am Horizont hingen. Ihr Leuchten erhellte den Straßenzug, was den Anblick nicht besser machte natürlich, doch fiel Juli die Orientierung leichter…“ (S. 218/219)
Irgendwie passt es nicht zusammen, das Prekariat und wie Baron darüber schreibt. Und das sage ich nicht als Bildungsbürgerin, sondern als Arbeiterkind, das aus einem ähnlichen sozialen Milieu kommt wie Barons „Drei Schwestern“. Figuren und Milieu sind nicht authentisch. Und warum am Ende alle, mit dem zufrieden sind, was sie haben, obwohl sie alle „mehr können“ leuchtet erst recht nicht ein. Macht aber vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung in der Familie, wie sie sich in „Ein Mann seiner Klasse“ zeigt, Sinn. Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre war mehr möglich, auch für Arbeiterkinder. Vor allem durch Bildung. Höhere Schulen und Universitäten waren für alle zugänglich, auch wenn es für Arbeiterkinder extremer Anstrengung und großer Durchsetzungskraft bedarf. Es gab Bafög und kostenlose Nachhilfe. So bin ich nicht glücklich mit Barons Schilderung, die die Möglichkeiten außer acht und die Restriktionen unüberwindbar erscheinen lässt. Aber vielleicht ist der Roman von Baron als Reminiszenz an Tschechows „Drei Schwestern“ gedacht, die in unerfüllter Sehnsucht nach einem besseren Leben in Tatenlosigkeit verharren? „Drei Schwestern“ ist der Abschluss von Christian Barons Kaiserslauterer Familien-Trilogie. Ein überzeugendes Buch ist es nicht.
Christian Baron: Drei Schwestern
Claassen, Juli 2025
336 Seiten, gebundene Ausgabe, 24,00 Euro
Diese Rezension wurde verfasst von Sabine Sürder.