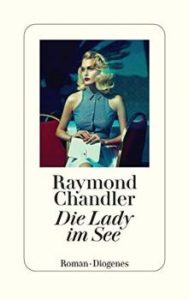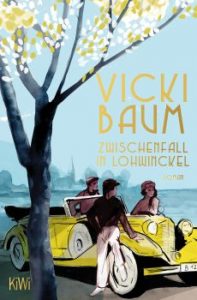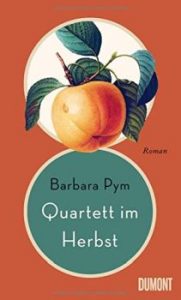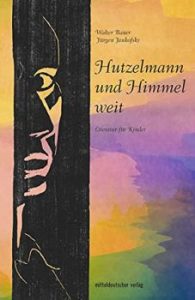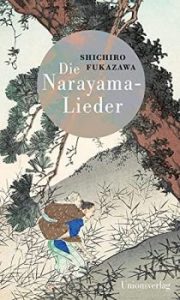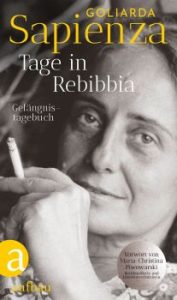 Irgendwann ging es nicht mehr weiter. Die Autorin Goliarda Sapienza (1924–1996) hatte alle Karten in ihrem Leben ausgereizt, und es schien, dass all ihre Entbehrungen umsonst gewesen waren. Zehn Jahre hatte sie an ihrem Lebenswerk geschrieben, unter Depressionen gelitten, und die Verleger lehnten ihr unkonventionelles Manuskript ab. Wäre sie ein Mann gewesen, hätten die Verleger vermutlich das umfangreiche Buch herausgebracht. Aber das literarische Werk hatte eine moderne, unabhängige Frau geschrieben. Mittel- und obdachlos stand sie da, und keiner wollte sie für ihre Arbeit entlohnen. Und weil sie eine Dekade lang nur für ihr Opus lebte, gab es in dieser Zeit auch keine Veröffentlichungen, die für sie sprachen.
Irgendwann ging es nicht mehr weiter. Die Autorin Goliarda Sapienza (1924–1996) hatte alle Karten in ihrem Leben ausgereizt, und es schien, dass all ihre Entbehrungen umsonst gewesen waren. Zehn Jahre hatte sie an ihrem Lebenswerk geschrieben, unter Depressionen gelitten, und die Verleger lehnten ihr unkonventionelles Manuskript ab. Wäre sie ein Mann gewesen, hätten die Verleger vermutlich das umfangreiche Buch herausgebracht. Aber das literarische Werk hatte eine moderne, unabhängige Frau geschrieben. Mittel- und obdachlos stand sie da, und keiner wollte sie für ihre Arbeit entlohnen. Und weil sie eine Dekade lang nur für ihr Opus lebte, gab es in dieser Zeit auch keine Veröffentlichungen, die für sie sprachen.
Goliarda Sapienza hatte also alle Karten ausgespielt und wie jeder andere lebendige Mensch Hunger und andere Bedürfnisse. Wer keine Gönner oder Spender zur Hand hat, der greift schon mal zu. Also griff sie zu und erleichterte eine Bekannte. Statt den Wertgegenstand zu versilbern, wurde sie geschnappt, verurteilt und landete 1980 am Ende des Sommers für ein paar Monate in einem römischen Frauengefängnis. Dieses hatte gerade einige Reformen durchlebt: Es gab keine Nonnen mehr als Aufsichtspersonal, und die Gefängniskleidung wurde abgeschafft. Nun regelten die inhaftierten Frauen ihren Alltag zum Teil eigenständig. Weiterlesen


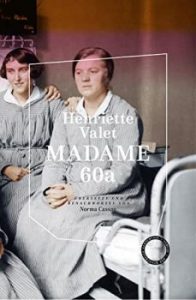 Henriette Valet (1900 – 1993) war in Paris Schriftstellerin und Journalistin. Sie schrieb für linke Arbeiter- und Gewerkschaftsblätter, Romane und darüber hinaus Theaterstücke. In der Szene linker Intellektueller lernte sie den marxistischen Philosophen und Soziologen Henri Lefebvre kennen, den sie 1936 heiratete. Nach 1946 verlieren sich ihre literarischen Spuren. Ihr Roman Madame 60a wurde 1934 veröffentlicht und erfuhr mehrere Auflagen.
Henriette Valet (1900 – 1993) war in Paris Schriftstellerin und Journalistin. Sie schrieb für linke Arbeiter- und Gewerkschaftsblätter, Romane und darüber hinaus Theaterstücke. In der Szene linker Intellektueller lernte sie den marxistischen Philosophen und Soziologen Henri Lefebvre kennen, den sie 1936 heiratete. Nach 1946 verlieren sich ihre literarischen Spuren. Ihr Roman Madame 60a wurde 1934 veröffentlicht und erfuhr mehrere Auflagen.