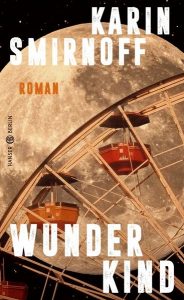„Wunderkind“ von Karin Smirnoff ist ein Roman, der wehtut, der anstrengt. Ein Roman, den man liest, obwohl man ihn nicht lesen will, den man abbricht, obwohl man weiterlesen möchte.
In Ich-Form erzählt Agnes ihre Geschichte. Ihre Geschichte als Tochter von Anitamama. Anita, die alles ist, nur ganz sicher nicht das, was das Wort „Mama“ bedeutet. Von Geburt an hasst, ja verabscheut Anita ihre Tochter, gibt ihr die Schuld an ihrem eigenen Versagen, dem Ende ihrer vermeintlichen Karriere, dem Verlust ihrer Schönheit, dem Verlassensein.
Sie vernachlässigt das Kind, das erst in die Obhut der Großmutter kommt, dann aber doch zu Anita muss. Sie lässt Agnes hungern, versorgt sie nicht mit ausreichend Kleidung. Sie erzählt Lügen über ihr eigenes Kind. Und sie verbietet ihr das Einzige, was Agnes wirklich etwas bedeutet. Das Klavierspielen.
Denn Agnes ist ein Wunderkind. Schon als sie noch ganz klein ist, kann sie nach dem Gehör und nach eigenem Gespür ganz wunderbar Klavier spielen. Doch die Mutter neidet ihr dieses Talent, übertrifft das Kind doch ihre eigenen, längst nicht in solchem Maße vorhandenen Fähigkeiten, wie Anita von sich selbst glaubt.
Erst als Frank Leide, ein Talentförderer, der auch schon mit Anita gearbeitet hatte, in Agnes‘ Leben tritt, scheint sich ihre Situation zu bessern. Heimlich übt er mit ihr, mit ihr und anderen Kindern, Jungen. Hier ahnt man oder befürchtet vielmehr, worauf das dann hinausläuft.
Als schließlich Agnes ein Brüderchen bekommt, ergeht es diesem wenig besser als dem Mädchen. Wenn nicht Agnes, die selbst immer noch ein kleines Kind ist, sich um das Baby kümmern würde, würde er wohl verhungern.
Leidenschaft für die Musik
So geht es durch den gesamten Roman, Szenen, in welchen Agnes ihrer Leidenschaft für die Musik frönen kann, wechseln mit ganz erschütternden Beschreibungen, zu was Anita fähig ist. Und schließlich zu den Schilderungen und Rückblicken auf das Leben von Frank Leide, der immer größeren Raum in der Geschichte einnimmt.
Ich muss ehrlich zugeben, dass mich der Roman abstößt. Nicht stilistisch, sondern inhaltlich. Er ist schwer zu ertragen, wenn, dann immer nur in kleinen Dosen, kurzen Abschnitten. Erschwerend kommt die, in meinen Augen völlig unnötige Formatierungseigenheit hinzu. Denn es gibt im gesamten Buch keinerlei Satzzeichen als den Punkt am Satzende. Keine Kommata, keine Anführungszeichen bei wörtlicher Rede, nichts dergleichen. Das erschwert die Lektüre ungemein, macht sie neben dem inhaltlichen Aspekt sehr ermüdend. Der Sinn einer solchen Eigenheit erschließt sich mir leider nicht. Ein Roman sollte durch seinen Inhalt und seinen Stil wirken, durch Figuren und Plot, und es nicht nötig haben, durch solche formellen Besonderheiten aufzufallen.
Insgesamt fällt es mir schwer, den Roman zu empfehlen, ob er lesenswert ist, muss jede selbst entscheiden.
Karin Smirnoff: Wunderkind.
Aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein.
Hanser Berlin, Januar 2023.
319 Seiten, gebundene Ausgabe, 26,00 Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von Renate Müller.