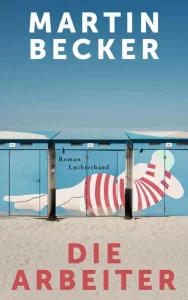Der deutsche Autor Martin Becker (Jahrgang 1982) hat ein autofiktionales Buch mit dem Titel „Die Arbeiter“ geschrieben. Der Luchterhand Literatur Verlag veröffentlichte es am 13. März 2024 in seinem Frühjahrsprogramm.
Tag für Tag Maloche und einmal im Jahr Nordsee
In „Die Arbeiter“ erzählt Martin Becker die Geschichte einer Familie, die vom Ruhrgebiet in eine sauerländische Kleinstadt gezogen ist und in einem mit Krediten finanzierten Reihenhaus lebt. Der Vater arbeitet im Bergbau, die Mutter verdient sich als Näherin ein Zubrot. Sie haben vier Kinder. Eins davon, Lisbeth, die Älteste, ist adoptiert und sitzt im Rollstuhl. Dann sind da noch Kristof und Uta. Und der Ich-Erzähler Martinus, der „Kurze“ und das jüngste Kind in der Familie.
Der Alltag wird vom Schmiedehammer im Tal, von der Maloche in Wechselschicht, vom Feierabend-Bier und -Schnaps und den billigen Zigaretten aus Polen bestimmt. Der Lichtblick im Sommer: die Familie fährt an die Nordsee. Nicht direkt ans Meer, sondern in eine billige Ferienwohnung im Hinterland. Aber sie sind glücklich.
Die Eltern rauchen wie die Schlote der Fabriken, ob im Kleinwagen oder in der Wohnung, überall riecht es nach kaltem Qualm. Sie sterben früh. Und Lisbeth auch. „Der Kurze“ ist weggezogen aus dem Sauerland und selbst Vater geworden. Kristof ist in der Nähe geblieben und kümmert sich. Uta ist verschwunden und lebt im belgischen Oostende. Die Ursprungsfamilie des Erzählers gibt es nicht mehr.
„Arbeiterkind wird man nicht, Arbeiterkind ist man.“
Wie wahr. Martin Becker beschreibt in „Die Arbeiter“ ein Milieu, in dem ich selbst auch aufgewachsen bin. Und obwohl ich mehr als zwanzig Jahre vor dem Autor geboren bin, berührt mich das Buch in vielerlei Hinsicht: die harte, körperliche Arbeit, das fehlende Geld, die karge Freizeit, die spärlichen Sozialkontakte, die Scham über die einfachen Verhältnisse, die Schikanen der „Gutbürgerlichen“, aber auch der familiäre Zusammenhalt und die unbedingte Loyalität. Und ich wundere mich ein wenig darüber, dass es ein Anfang der 1980er Jahre geborenes Arbeiterkind immer noch so erlebt hat. Doch letztlich enthält dieser Roman die traurige Geschichte über Menschen, die sich tot geschuftet, geraucht und gesoffen haben. Die vergeblich auf den Sechser im Lotto gewartet und im Aldi nach Sonderangeboten geguckt haben. Und trotzdem hatte es der Erzähler als „Nesthäkchen“ der Familie gut, er wurde umsorgt und besonders von der Mutter geliebt und verwöhnt. So sagt er an einer Stelle des Buches, die Bergarbeiter-Welt arg verklärend: „Es ist schön hier. Aber man will ja immer erst dann nach Hause, wenn es nicht mehr geht.“ (S. 32)
Martin Becker hat einen autofiktionalen Roman geschrieben, d.h. er kombiniert wahrhaftig Erlebtes mit fiktionalen, erfundenen Elementen. Eins davon ist die Umschreibung der Geschichte seiner Schwester Uta, die angeblich die Familie verlassen hat, als sie alt genug dazu war. Becker schont sich bzw. seinen Ich-Erzähler nicht. Er spricht von seiner Eifersucht auf die behinderte Schwester Lisbeth, darüber, wie er seinem Bruder Kristof die Fürsorge für seine Eltern und Lisbeth komplett überlässt, bis hin zur Abwicklung der Beerdigungen und den Verkauf des alten Reihenhauses. Der Vater stirbt mit 68 Jahren, die Mutter wird pflegebedürftig, die Schwester bleibt es ihr Leben lang. Und der jüngste Sohn stürmt mit wehenden Fahnen davon. Macht als erster in der Familie Abitur, zieht aus, studiert und „bricht damit allen das Herz“. Und er schleppt seine proletarischen Gene in die eigene Kleinfamilie. Was bleibt ist die Sehnsucht nach dem Meer, nach dem Glück.
Die Arbeiter sind die Dinosaurier der sozialen Milieus, sie sterben aus
„Die Arbeiter“ von Martin Becker treffen mich als Lesende ins Herz und berühren mich mitunter auf eine mir unangenehme Art und Weise. Die Geschichte über die „einfachen“ Leute versetzt mich zurück in die eigene Kindheit und wirbelt viel Verdrängtes auf. Aber sie bestätigt mir auch, dass man die soziale Herkunft nicht nur als Ballast, sondern auch als Rückenwind begreifen kann. Ich halte den Roman jedoch nicht für eine Liebeserklärung oder gar ein Denkmal an das Arbeiter-Millieu, das im Aussterben begriffen sein soll (wie im Klappentext des Buches zu lesen ist), sondern eher um eine Bilanz über die eigene Herkunftsfamilie, die im Laufe der Jahre die Haben-und-Soll-Seiten in einem milderen Licht erscheinen läßt. Aber bitte lesen Sie selbst!
Martin Becker: Die Arbeiter.
Luchterhand Literatur Verlag, März 2024.
304 Seiten, Hardcover, 22,00 Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von Sabine Sürder.