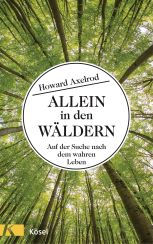 Der Autor und Ich-Erzähler versucht in der Einsamkeit zu sich selbst zu finden. Fast zwei Jahre verbringt er in einem abgeschiedenen Haus im Wald, wo er ohne Computer, Handy und Fernseher lebt. Wie kommt jemand damit klar, alles Vertraute, alle Annehmlichkeiten des Lebens hinter sich zu lassen und sein Heil allein in der Natur zu suchen? Howard Axelrod zeichnet diese Erfahrung eindrücklich und spannend mit schön zu lesenden poetischen Naturbeschreibungen auf.
Der Autor und Ich-Erzähler versucht in der Einsamkeit zu sich selbst zu finden. Fast zwei Jahre verbringt er in einem abgeschiedenen Haus im Wald, wo er ohne Computer, Handy und Fernseher lebt. Wie kommt jemand damit klar, alles Vertraute, alle Annehmlichkeiten des Lebens hinter sich zu lassen und sein Heil allein in der Natur zu suchen? Howard Axelrod zeichnet diese Erfahrung eindrücklich und spannend mit schön zu lesenden poetischen Naturbeschreibungen auf.
Ein Sportunfall hat ihn, den erfolgreichen Harvard-Studenten, der die besten Chancen auf eine erfolgreiche Berufskarriere hatte, aus der Bahn geworfen. – Nach einer unglücklichen Aktion eines Mitspielers während eines Baseballspiels, erblindet er auf einem Auge. Diese erschwerte Lebenssituation und eine unglücklich endende Liebe lassen ihn den Halt im Leben verlieren. Obwohl er verständnisvolle Eltern und Freunde hat, findet er sich nicht mehr unter ihnen zurecht. Er folgt seinem inneren Gefühl, ein einfaches Dasein inmitten der Natur zu führen, ohne sich vor sich selbst oder anderen verstellen zu müssen.
Den neugewählten Lebensmittelpunkt präferiert er vor allem wegen der dort vorherrschenden Stille. So kann er sich besser auf das Hören konzentrieren, auf das sich seine Sinne nach dem Unfall nun vermehrt fokussieren. Zudem muss er hier keinerlei Erwartungshaltungen erfüllen.
Konfrontiert mit den Sinnfragen des Lebens, durchkreuzen seine Gedanken immer wieder Erinnerungen an Milena, seine große vergangene Liebe. Im Wechsel mit diesen Einschüben beschreibt er, wie er sich recht schnell mit den Naturgesetzen arrangiert und sich nur noch auf ganz elementare Bedürfnisse konzentriert. Sein Zeitgefühl orientiert sich am Sonnenstand, an den Sternen oder ganz einfach daran, wie lange es dauert, bis das Wasser kocht. Er nimmt den Wandel der Jahreszeiten ganz bewusst wahr und nach einem Jahr fragt er sich selbst, ob sein Selbstfindungstrip, seine Suche nach Erleuchtung nicht in Wirklichkeit eine Flucht war.
An Thanksgiving nimmt er den weiten Weg auf sich und fährt zum alljährlichen Familientreffen. Die Normalität der Welt in der seine Eltern und Verwandten leben, ist ihm fremd geworden. Seine Cousine Susan ist es, die Ähnlichkeiten zu H. D. Thoreaus Schilderungen in seinem Roman „Walden“ und dem jungen McCandless, dessen Schicksal im Film „Into the Wild“ aufgezeigt wird, anstellt, was in Teilbereichen zutrifft.
Das Zusammentreffen mit den vertrauten Menschen erzeugt kein Glück, sondern ein Fremdheitsgefühl. Von den ersten Minuten an fühlt er sich unverstanden und sehnt sich nach seinem Zuhause in den Wäldern, wohin er wieder zurückkehrt.
Erst nach einem einschneidenden Erlebnis auf einem kalten Feld wird ihm bewusst, wo seine Zukunft angesiedelt ist: „Ich hatte verstanden, dass ich nicht nur die Person war, die andere in mir sahen, sondern dass man ohne seine Mitmenschen niemals begreift, was sonst noch für Möglichkeiten in einem schlummern. Diese Wälder, diese Wildnis hatten mir eine zweite Chance gegeben, hatten mich gelehrt, ganz neu zu sehen…“.
Howard Axelrod: Allein in den Wäldern: Auf der Suche nach dem wahren Leben.
Kösel-Verlag, April 2017.
288 Seiten, Gebundene Ausgabe, 19,99 Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von Annegret Glock.