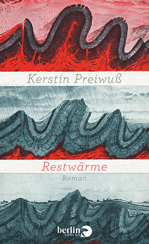 Ein eindringlicher Roman über etwas so Schwieriges und Widersprüchliches wie Heimatverbundenheit und Familienzugehörigkeit ist Kerstin Preiwuß mit „Restwärme“ gelungen.
Ein eindringlicher Roman über etwas so Schwieriges und Widersprüchliches wie Heimatverbundenheit und Familienzugehörigkeit ist Kerstin Preiwuß mit „Restwärme“ gelungen.
Die Autorin, die 1980 selbst in einem kleinen Kaff in der mecklenburgischen Provinz geboren wurde, beschreibt aus der Ich-Perspektive eine junge Frau, die nach Jahren in ein solches Dorf zurückkehrt. Ihr Vater ist gestorben und sie verbringt einige Tage mit ihrem Bruder und ihrer Mutter im Haus ihrer Kindheit. Man ahnt, dass Kerstin Preiwuß vieles aus ihrer eigenen Vergangenheit für diese Geschichte verwendet hat.
Kindheitserinnerungen kommen hoch, und der Leser merkt schnell, dass diese Kindheit alles andere als rosig war. Der Vater war ein aggressiver Säufer, der vor allem dem Sohn täglich auf wüsteste Weise zugesetzt hat. Mit Schlägen wollte er einen Mann aus ihm machen. Das hat nicht funktioniert. Der Sohn bricht nach der achten Klasse die Schule ab, quält Tiere und ist auch noch als Erwachsener ein unsicherer und verstörter Mensch. Die Mutter war immer zu schwach, sich gegenüber ihrem tyrannischen Ehemann durchzusetzen. Ihr Credo nach Jahrzehnten der Unterdrückung: „Aber es war doch nicht alles schlecht.“
Der Ich-Erzählerin Marianne ist es trotzdem gelungen, sich in dieser wenig förderlichen Umgebung zu behaupten, trotz eines eigenen Kindes im Teenageralter das Abitur zu schaffen, zu studieren und sich in Berlin ein neues Leben aufzubauen.
Konfrontiert mit der Vergangenheit, durchströmen sie widersprüchliche Gefühle. Einerseits sind die Aggressionen gegenüber dem Bruder und der Mutter sowie der Hass auf den Vater sofort wieder da, aber da ist – unterschwellig – auch noch etwas anderes: die Restwärme. Lesenswert!
Kerstin Preiwuß: Restwärme.
Berlin-Verlag, Juli 2014.
240 Seiten, Gebundene Ausgabe, 18,99 Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von Andreas Schröter.