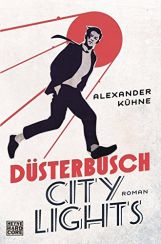 Kleine Städte, große Träume: Das ist im Osten der 80er Jahre nicht anders als im Westen, nur in der Umsetzung noch eine Nummer impraktikabler. Anton wohnt im brandenburgischen Düsterbusch, und das ist schon sehr klein; sein Traum ist, ebendort einen subversiven Club nach Londoner Vorbild aufzuziehen, und mehr muss man vielleicht gar nicht wissen über Anton.
Kleine Städte, große Träume: Das ist im Osten der 80er Jahre nicht anders als im Westen, nur in der Umsetzung noch eine Nummer impraktikabler. Anton wohnt im brandenburgischen Düsterbusch, und das ist schon sehr klein; sein Traum ist, ebendort einen subversiven Club nach Londoner Vorbild aufzuziehen, und mehr muss man vielleicht gar nicht wissen über Anton.
Bevor er allerdings Hochhäuser, Casinos und David Bowie nach Düsterhaus bringen kann, gilt es, sich durch den Alltag der DDR zu manövrieren, ohne dabei den Biss, die Vision oder gleich den Verstand zu verlieren. Gut, wenn man dabei Freunde hat wie Henryk, den coolen Polen, den durchgeknallten Punk Baader (inklusive Band, in der Anton den Bierflaschenzerschmeißer geben darf) und Sprenzel, der weder cool noch punk ist, sondern verlässlich und sich selbst und anderen treu, und der eigentlich nur möchte, dass alles in Düsterbusch bleibt, wie es ist.
Und dann gibt es da noch die schöne Conny.
Mit dem Mut der Verzweiflung (und manchmal auch nur Verzweiflung) setzt Anton quer durch die 80er Jahre hindurch alles daran, seinen Lebenstraum zu verwirklichen, um jeden Preis. Wie hoch dieser Preis aber wirklich ist, und dass selbst das allergrößte Opfer das Scheitern möglicherweise nicht abwehren, sondern sogar herbeiführen kann, erfährt er allerdings erst, als das Jahrzehnt und der verhasste Staat sich gleichermaßen ihrem Ende zuneigen.
„Düsterbusch City Lights“ ist ein Buch, das ich nach der Lektüre erstmal sacken lassen musste. Die Reise entlang Antons Lebensweg von den tiefen 70ern bis hinein ins Jahr 1989 liest sich sehr locker und amüsant weg, aber der eigentliche Effekt zeigt sich wie beim vielbemühten Beispiel Wein quasi erst im Abgang – nämlich in den Lesepausen, wenn einem dämmert, was genau einem da eigentlich so lakonisch erzählt wurde. Denn der leichte Ton täuscht. Wie bei den norddeutschen Schwergewichten des Quasi-Persönlichen, Heinz Strunk und Rocko Schamoni, stellt man sich bei „Düsterbusch City Lights“ lieber nicht die Frage, inwieweit das Beschriebene tatsächlich autobiographisch ist – man wünscht es sich nicht, befürchtet es aber.
Trotzdem, oder auch gerade deswegen, hätte ich mir von dem Roman, der sich ja im Bereich der Tragikomödie bewegt, vielleicht (noch) stärkere Eindeutigkeit sowohl im Tragischen wie im Irrwitzigen gewünscht – denn gerade der bürokratische DDR-Alltag mit seinen possenhaften, gleichwohl unhinterfragt in Stein gemeißelten Abläufen besitzt ein grandioses Potenzial an Absurditäten, staatlich verordneten Sinnlosigkeiten, die einen energiegeladenen jugendlichen Querdenker entweder in die Verzweiflung oder eine knochenharte Subversivität treiben müssen. Antons Kampf gegen Behörden und staatlich verordnete Zukunftsmodelle fand ich auch so schon sehr unterhaltsam, aber für meinen Geschmack hätte man hier durchaus noch ein wenig an der Überspitzungsschraube drehen können; möglich ist allerdings auch, dass mir als Wessi einige Anspielungen unter dem Radar durchfliegen.
Auch das eigene Bewusstsein für die Tragik des Geschilderten hätte für mein Empfinden etwas stärker durchschlagen können – in unerschütterlicher Stoik schildert Anton die Katastrophen seines Lebens, kompensiert wird allenfalls alkoholisch, und bis zum finalen Paukenschlag kurz vor Schluss bekommt man als Leser eigentlich nicht den Eindruck, dass ihm diese durchaus nicht banalen Widrigkeiten so viel ausmachen. Vielleicht, weil der Traum vom Düsterbuscher Blitz Club alles andere überstrahlt? Auch das hätte man vielleicht stärker herausarbeiten können; das Buch ist wunderbar, so wie es ist, aber meiner Meinung nach hätte ein stärkeres Ausleuchten der Höhen und Tiefen dem Roman noch mehr Wucht verliehen.
Wer einen Roman sucht, in dem vor dem Hintergrund pubertärer Selbstfindung mit dem „Unrechtsstaat DDR“ abgerechnet wird, ist hier definitiv falsch. Eine Auseinandersetzung mit dem politischen System über das Persönliche hinaus findet in „Düsterbusch City Lights“ nicht statt, das ist auch nicht das Anliegen des Buches. Die Hürden, mit denen Anton zu tun hat, sind in dieser Form zwar DDR-spezifisch, aber die Grunderfahrung ist eine universelle, und die Art, in der Alexander Kühne sie aufarbeitet, trägt diesem Umstand Rechnung: Man muss kein Hintergrundwissen zum Staatssystem DDR mitbringen, um Anton zu verstehen, man muss nur einmal jung, idealistisch und musikverrückt gewesen sein.
So passt auch „Düsterbusch City Lights“ meines Erachtens eher in das überraschend langlebige Sub-Genre „Musikaffine Herren besten Alters blicken auf ihre wilde Jugend zurück“ als in irgendeinen DDR-Lektürekanon – weniger derb als „Fleisch ist mein Gemüse“, mit mehr Substanz und deutlich weniger Nostalgie als Frank Goosens „Liegen lernen“ (das ich auch gern gelesen habe), ähnelt es meiner Meinung nach noch am meisten den „Dorfpunks“ von Rocko Schamoni, ist aber doch ein ganz eigenständiges Werk. Von Herrn Kühne werde ich gern noch mehr lesen.
Alexander Kühne: Düsterbusch City Lights.
Heyne, Februar 2016.
384 Seiten, Taschenbuch, 14,99 Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von G. K. Nobelmann.