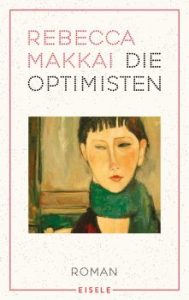 Nico ist tot. Gestorben an dem Virus, das die Gesellschaft viel zu lange ignoriert hat, weil es vor allem schwule Männer trifft, und das von einigen sogar zur Strafe Gottes erklärt wurde. Es ist 1985, Aids beginnt auch in Chicago zu grassieren. Die Eltern hatten Nico wegen seiner Homosexualität verstoßen, seine einzige Vertraute in der Familie war seine jüngere Schwester Fiona. Sie hat ihn, gemeinsam mit seinen Freunden aus „Boystown“, bis zu seinem Tod begleitet.
Nico ist tot. Gestorben an dem Virus, das die Gesellschaft viel zu lange ignoriert hat, weil es vor allem schwule Männer trifft, und das von einigen sogar zur Strafe Gottes erklärt wurde. Es ist 1985, Aids beginnt auch in Chicago zu grassieren. Die Eltern hatten Nico wegen seiner Homosexualität verstoßen, seine einzige Vertraute in der Familie war seine jüngere Schwester Fiona. Sie hat ihn, gemeinsam mit seinen Freunden aus „Boystown“, bis zu seinem Tod begleitet.
Auch Yale war Nicos Freund. Der junge Mann arbeitet in der Brigg Gallery und hat derzeit einen großen Fisch an der Angel. Nora Lerner, Nicos und Fionas Großtante, hat der Galerie eine Schenkung angekündigt: Werke berühmter (und weniger berühmter) Künstler vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, für die Nora in ihrer Zeit in Paris Modell gestanden hatte. Obwohl Yale um seinen Freund (und die, die ihm noch folgen) trauert und die Epidemie ihn aufwühlt, konzentriert er sich auf seine Arbeit. Er fühlt sich sicher, weil er mit seinem Partner Charlie schon seit Jahren monogam lebt.
Dreißig Jahre später fliegt Fiona nach Paris, um ihre Tochter Claire zu suchen, die schon vor einiger Zeit den Kontakt zu ihr fast vollständig abgebrochen hat. Fiona plagt das schlechte Gewissen. Sie denkt, dass sie Claire keine gute Mutter war, weil sie in den Jahren um deren Geburt von den Dramen um das Virus in ihrem Umfeld nahezu absorbiert war. Nun hat Fiona einen Hinweis, dass ihre Tochter vielleicht in Paris lebt und beauftragt einen Privatdetektiv, sie bei ihren Nachforschungen zu unterstützen.
Sie kommt bei ihrem alten Freund Richard unter, der ebenfalls in den 1980er Jahren in Chicago gelebt hat und von der Krankheit verschont geblieben ist. Er ist in der Zwischenzeit ein berühmter Fotograf und bereitet eine Ausstellung vor, in der auch seine Zeit in Chicago eine wichtige Rolle spielt. Fiona wird die „Geister“ aus der Vergangenheit nicht mehr los, seit langem unterdrückte Gefühle drängen mit Macht ans Tageslicht.
Mit ihrem dritten Roman „Die Optimisten“ ist der US-amerikanischen Autorin Rebecca Makkai der Durchbruch gelungen. Er wurde – aus meiner Sicht hochverdient – sowohl auf die Shortlist des Pulitzer Prize als auch des National Book Award gewählt und mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Bettina Abarbanell hat den Roman einfühlsam ins Deutsche übersetzt.
Geschickt verknüpft Rebecca Makkai die verschiedenen Zeitebenen und blickt über Noras Erzählung sogar ins Paris der 1920er Jahre zurück. Es gelingt ihr, Paris damals und heute, ganz besonders aber „Boystown“ im Chicago der 1980er so lebendig zu machen, dass ich fast meinte, „zur Familie“ zu gehören. Man spürt die überschäumende Lebenslust genauso wie die Furcht vor dem Ausgestoßensein und der Krankheit, die Liebe, Solidarität und Freundschaft genauso wie den Verrat, der oft der eigenen Hilflosigkeit entspringt.
Dabei zeichnet sie vielschichtige Figuren und lässt die Leserinnen und Leser ganz tief in deren Herz, Seele und Gedanken schauen. Ich habe jedem Einzelnen, egal ob Mann oder Frau, die Daumen gedrückt, dass sie ein Leben leben können, wie sie es sich erträumen – ohne Ausgrenzung und schräge Blicke. Auch wenn wir heute in vielen Teilen der Welt eine viel offenere Gesellschaft sind, werden Menschen, die – in welcher Form auch immer – als „anders“ angesehen werden, noch immer ignoriert, diskriminiert oder im schlimmsten Fall Opfer von körperlicher oder psychischer Gewalt.
„Die Optimisten“ ist erschütternd und fesselnd, warmherzig erzählt und berührend. Ein großartiges Stück Literatur, das ich nur wärmstens empfehlen kann.
Rebecca Makkai: Die Optimisten.
Eisele Verlag, März 2020.
624 Seiten, Gebundene Ausgabe, 24,00 Euro.
Diese Rezension wurde verfasst von Beate Fischer.